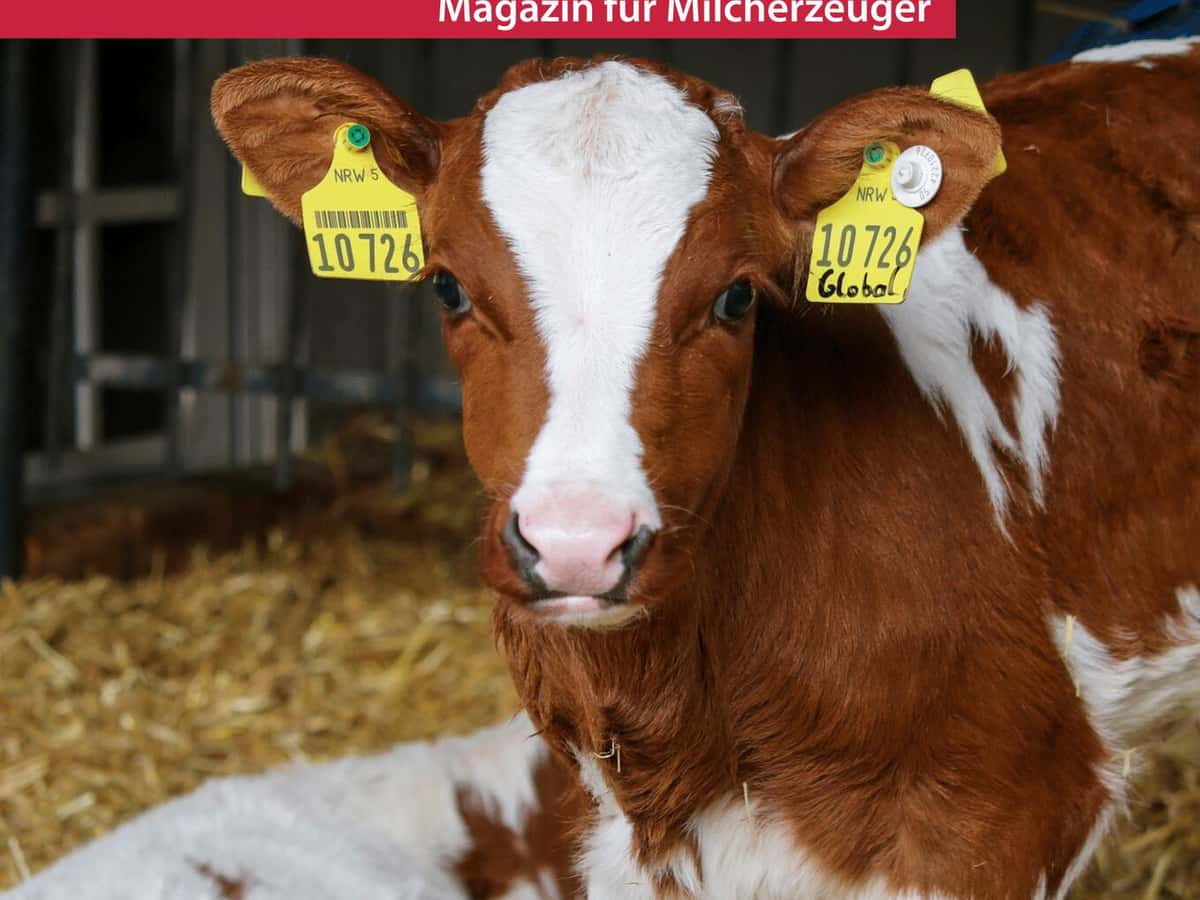Cultan-Verfahren
Beim Cultan-Verfahren (Controlled uptake long term ammonium nutrition) wird Ammonium-Flüssigdünger mit Sterninjektionsrädern ca. 5 bis 7 cm tief als Depot in Wurzelnähe in den Boden eingebracht. Ziel ist eine verlustärmere N-Düngung und eine bessere Nährstoffverfügbarkeit. In der Regel wird für das Injektionsverfahren Ammonium-Sulfat-Lösung (ASL) mit etwa 8 % Ammoniumstickstoff und 9 % Schwefel eingesetzt.
Eine bessere Stickstoffausnutzung und damit eine...
Cultan-Verfahren
Beim Cultan-Verfahren (Controlled uptake long term ammonium nutrition) wird Ammonium-Flüssigdünger mit Sterninjektionsrädern ca. 5 bis 7 cm tief als Depot in Wurzelnähe in den Boden eingebracht. Ziel ist eine verlustärmere N-Düngung und eine bessere Nährstoffverfügbarkeit. In der Regel wird für das Injektionsverfahren Ammonium-Sulfat-Lösung (ASL) mit etwa 8 % Ammoniumstickstoff und 9 % Schwefel eingesetzt.
Eine bessere Stickstoffausnutzung und damit eine Einsparung von Dünger, zudem weniger Emissionen, weniger Auswaschung und weniger Überfahrten. Diese Vorteile des Cultan-Düngeverfahrens schätzen viele Ackerbauern seit Jahren auf ihren Flächen. Vor allem im Süden kommt das Verfahren, bei dem mit einer Injektorwalze Flüssigdünger als Depot 6 cm tief im Boden appliziert wird, in letzter Zeit nun auch verstärkt im Grünland zum Einsatz.
Die Praktiker berichten von besseren Futterqualitäten und mehr Ertrag: „Die Energie- und Proteingehalte im Futter sind höher und wir ernten 10 bis 15 % mehr Masse“, berichtet Max Häußler, Milchkuhhalter aus Ravensburg-Horgenzell (Baden-Württemberg). Im Schnitt erntet er 130 dt Frischmasse pro Hektar.
Im ersten Schnitt 2022 erzielte er nach der Cultan-Düngung 6,7 MJ NEL mit 142 g nXP und 163 g/kg TS Rohprotein. Mit einer derartigen Düngung vor dem 2. Schnitt 2021 konnte er 6,5 MJ NEL/kg TS mit 143 g nXP und 190 g/kg TS Rohprotein verbuchen. „Durch die höheren Rohproteingehalte konnten wir 1 kg Eiweißfutter aus der Ration der Milchkühe rausnehmen.“ Für die Düngung seiner 25 ha Dauergrünland lässt er bereits seit drei Jahren das Lohnunternehmen Gebrüder Deifel aus Ravensburg-Schmalegg mit seiner Cultanwalze kommen. Zusätzlich zu den 150 kg N/ha über Cultan, düngt er 15 m3/ha Gülle. Die in Studien festgestellten höheren Nitrat- und Sulfatgehalte (siehe Kasten) kann er bisher nicht bestätigen.
Wir konnten durch höhere Rohproteingehalte Eiweiß aus der Ration nehmen.
Max Häußler, Milcherzeuger aus Ravensburg
Gute Erfahrungen hat auch Hergen Wißmann aus Osterkappeln-Venne (Niedersachsen) gemacht, der bereits im 5. Jahr ASL mit 15 % Stickstoff und 6 % Schwefel einmalig vor dem 1. Schnitt per Cultan-Verfahren ausbringen lässt. Im Grünland hat er 100 kg N über das Cultanverfahren gedüngt, auf einigen Flächen zudem 60 kg N aus Rindergülle. „Der Masseertrag hat sich dadurch zwar nicht verändert, aber die Bestände sind jetzt vermutlich durch die bessere Nährstoffverfügbarkeit gesünder, gleichmäßiger grün und die Futterqualität ist besser“, glaubt er. Entsprechende Analysen stehen allerdings noch aus.
Vorsicht vor hohen Nitratgehalten!
Bisher gibt es erst sehr wenige Studien und „harte Fakten“ zum Einsatz des Cultan-Verfahrens auf Grünland. Versuche der Landwirtschaftskammer Niedersachsen haben damit 2010 im Grünland zwar höhere Eiweißgehalte und Eiweißerträge gezeigt, allerdings war bei einer kombinierten Düngung mit Rindergülle gleichzeitig das Risiko für hohe Nitrat- und Sulfatgehalte im Futter erhöht. So wurde z.B. auf einem Marschboden mit 80 kg N/ha per Cultanverfahren ein Proteingehalt von 15,9 % i. TM erzielt gegenüber 14,9 % mit herkömmlicher KAS-Düngung. Unabhängig vom Boden waren die Eiweißgehalte beim Injektionsverfahren um 1 bis 2 % höher. Allerdings standen Nitratgehalte von im Mittel 892 g/kg TM bei der KAS 80 kg N/ha-Variante, die einmal Gülle erhielt, 1.394 g/kg TM bei der Cultanvariante gegenüber.
Ertragseffekte konnten in der Versuchsreihe nicht festgestellt werden, vielmehr wurde vor zu hohen Schwefelmengen und bei nicht ausreichend tiefem Eindringen der Düsen in trockenem Boden vor Ätzschäden an den Blättern gewarnt. Von der Anwendung auf Moorböden haben die Berater aufgrund des niedrigen pH-Werts und aufgrund der hohen N-Nachlieferung abgeraten.
„Das Cultan-Verfahren als N-Depotdüngung für eine Kultur funktioniert im Ackerbau, die positiven Effekte können aber nicht einfach auf das Grünland übertragen werden“, gibt Grünlandexperte Martin Hoppe von der Landwirtschaftskammer NRW zu bedenken. Grünlandbestände auf Vorrat zu düngen, sei nicht zielführend, da im Vergleich zu Ackerkulturen mehrere Ernteschnitte erfolgten und nur durch eine entzugsbetonte Düngung jedes einzelnen Aufwuchses eine bedarfsgerechte N-Versorgung möglich sei.
Erfahrungen aus Praxisbetrieben hätten zu bedenklich hohen Nitrat- und NPN- (NPN: Non-Protein-Nitrogen) Gehalten in einzelnen Grünlandaufwüchsen geführt, die den Stoffwechsel der Tiere belasten können.
Wird das Verfahren bei Wassermangel interessanter?
Die höheren Proteingehalte, die Praktiker als einen Vorteil bei Cultan sehen, sieht Hoppe in erster Linie in einem optimaleren Schnittzeitpunkt und der Narbenzusammensetzung begründet und nicht so sehr in einer höheren Stickstoffmenge.
„Vorstellbar ist aber dennoch, dass das Verfahren in Zukunft an Bedeutung gewinnen könnte, wenn wir durch Klimaveränderungen mehr heiße, trockene Sommer bekommen und eine effiziente Stickstoff-Nachdüngung zum nächsten Schnitt aufgrund von Wassermangel nicht mehr funktioniert“, sagt Hoppe. Letztlich müsse dies aber durch ganzheitliche pflanzenbauliche und fütterungsrelevante Exaktversuche noch untersucht und begleitet werden.
Welcher Dünger?
Lohnunternehmer bieten die Technik mit den Injektionsstacheln in einer Arbeitsbreite von bis zu 15 m an. Je nach Düngermenge und Zuschnitt der Flächen sind 2 bis 10 ha pro Stunde möglich. Eingesetzt wird in der Regel ASL-Lösung, die Stickstoff- und Schwefelanteile darin können variieren. Das Lohnunternehmen Gebrüder Deifel setzt z.B. eine fertige Lösung mit 15 % N und 5 % Schwefel ein. Reinhold Deifel: „Mit einem niedrigeren Schwefelgehalt gegenüber der handelsüblichen ASL-Lösung verhindern wir eine Übersäuerung des Bodens.“ Lohnunternehmer Bernd Böck aus Isny setzt eine aus Gärresten über eine Verdampfungsanlage hergestellte ASL-Lösung mit 8 bis 9,5 % Stickstoff und 8 bis 10 % Schwefelsäure ein (siehe Kasten). „Damit sichern wir auf unterversorgten Flächen auch die Schwefelversorgung ab. Das Ergebnis ist vielfach ein besserer Futterwert“, sagt er.
Wichtig ist bei der Cultandüngung, den Schwefelgehalt im Auge zu behalten und an die Ertragserwartung bzw. an die Intensität der Nutzung anzupassen, um eine Auswaschung zu vermeiden. Zu beachten ist außerdem eine regelmäßige Kalkzufuhr, da die saure ASL-Lösung kalkzehrend wirkt.
Eigene ASL-Lösung aus Gärresten
Im Allgäu stellen Landwirte mit dem Verfahren der Vakkumverdampfung (Vapogant) aus den Gärresten ihrer Biogasanlage ihre „eigene“ ASL-Lösung (Farm-AS) für die Cultandüngung her. Sie enthält wie die handelsübliche ASL- Lösung 8,5 % Stickstoff und 9 % Schwefel. Dabei wird dem Gärrest durch eine Vakuumverdampfung sämtliches Wasser entzogen und gleichzeitig der flüchtige Stickstoff mit Schwefelsäure in einer Ammoniumsulfatlösung gebunden. Das eingedickte Substrat sei nach Aussage von Christof Maier, Landwirt und Mitinhaber der Biogastechnik Süd, die das Verfahren anbietet, vergleichbar mit flüssigem Kompost.
Sind die Bestände dadurch resistenter gegen Trockenheit?
Gedüngt wird meist ca. vier bis fünf Wochen vor dem ersten Schnitttermin, manchmal auch noch früher. Die Düngewirkung hält nach Aussage der Praxis meist für ca. zwei Schnitte an. „Bei uns profitiert meist der dritte Schnitt auch noch davon. Zudem ziehen die Bestände nach dem Schnitt schneller wieder an, auch wenn kein Regen kommen sollte“, so Max Häußler. Übereinstimmend erklären die Praktiker, dass die Cultan-gedüngten Bestände besser mit längerer Trockenheit klarkommen als konventionell gedüngte. Das liegt vermutlich daran, dass der Dünger schon im Wurzelbereich ist und nicht erst mit Wasser dorthin diffundieren muss. Die meisten Praktiker setzen das Verfahren einmalig vor dem 1. Schnitt ein, einzelne zusätzlich vor dem 4. Schnitt noch einmal.
Die Voraussetzungen
Damit das Injektionsrad überhaupt eingesetzt werden kann, darf der Boden nicht zu trocken sein, aber auch nicht zu naß. „Bei sehr langer Trockenheit, wenn z.B. bereits Bodenrisse sichtbar sind, können die Injektionsdüsen nicht genug in den Boden eindringen“, berichtet Lohnunternehmer Reinhold Deifel. Bei zu nassen Verhältnissen dagegen, kann das relativ schwere Gespann - wie ein volles Güllefass auch - zu starken Verdichtungen führen. „Allerdings bietet das Verfahren durch die Anlage eines stabilen Depots auch mehr Flexibilität beim Ausbringzeitpunkt“, so Lohnunternehmer Bernd Böck.
Die Kosten
Die Kosten für das Verfahren hängen von der jeweiligen Flächenstruktur ab, sind in Summe aber nicht ohne. Das Lohnunternehmen Gebrüder Deifel beispielsweise stellt 80 € pro Stunde für das Cultangerät in Rechnung zuzüglich der nötigen Schlepperstunden. Bernd Böck aus Isny nimmt 29,50 €/ha für die Cultantechnik plus die aufgewandten Schlepperstunden. „Die hohen Kosten sind für uns daran bisher der einzige Nachteil“, sagt Milchkuhhalter Hergen Wißmann. Allerdings müsse man die Einsparung an Dünger von 10 bis 20 % genauso gegenrechnen wie die Tatsache, dass damit Überfahrten eingespart würden.
Die Frühjahrsdüngung zum 1. Schnitt ist die wichtigste Düngungsmaßnahme in der Vegetationszeit. Was ist jetzt zu tun, um die Bestände gut aufzustellen?
Dürren und Schlagregen verdeutlichen die ertragsmindernden Effekte vorhandener Bodenverdichtungen im Dauergründland. Wann eine Unterbodenlockerung helfen kann.
Das Einbringen von Rot- und Weißklee in Grasnarben ist eine Möglichkeit, Stickstoffdünger einzusparen. Tipps, wie die Etablierung gelingt.