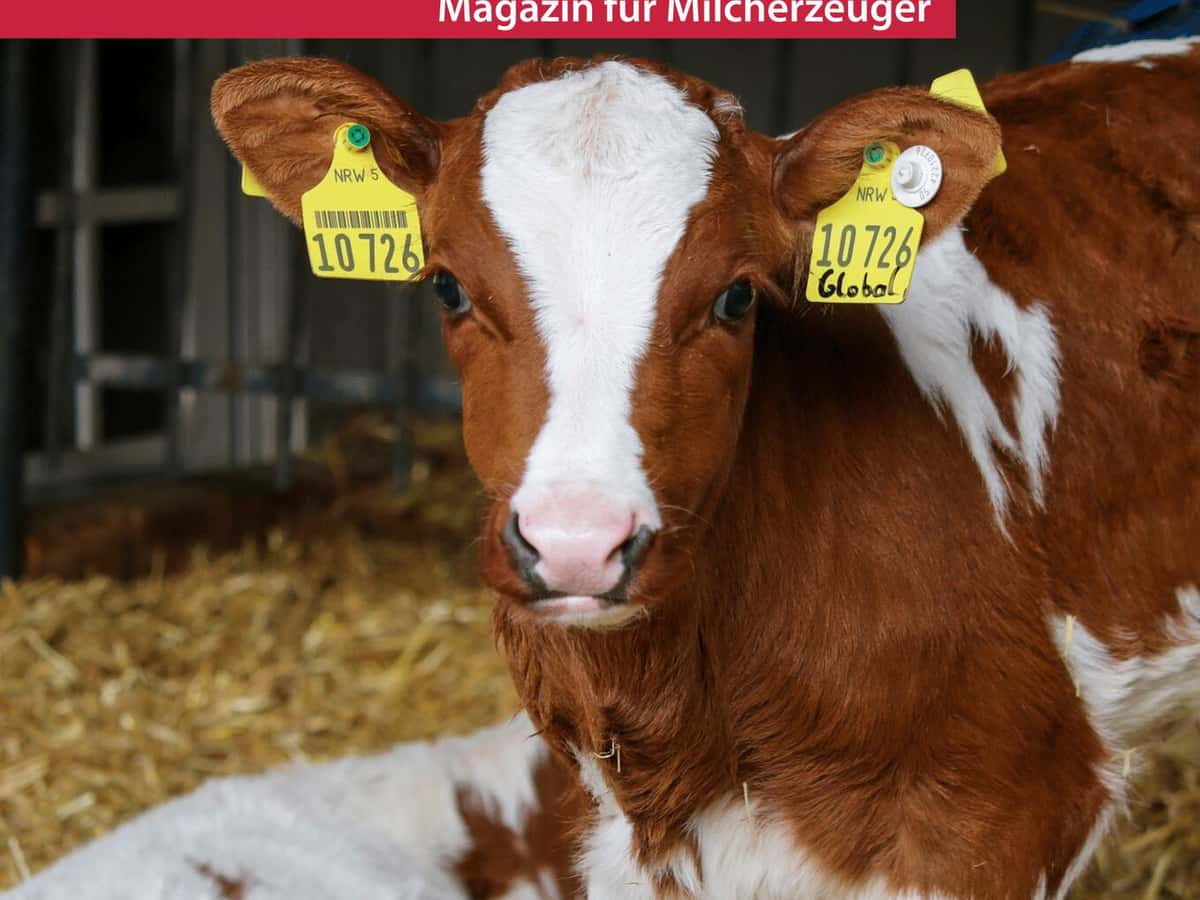Die Frühjahrsdüngung ist vielerorts in vollem Gange. Nach den explodierenden Düngerkosten im letzten Frühjahr hat sich die Situation in diesem Jahr wieder normalisiert. Deshalb gilt es nun umso mehr, die eigenen Grünlandbestände intensiv zu versorgen und bestmöglich für die kommende Futterbau-Saison aufzustellen.
Martin Hoppe, Grünlandberater der Landwirtschaftskammer NRW, gibt Tipps, wie Sie die Frühjahrsdüngung im Grünland bedarfsgerecht und dennoch möglichst effizient und...
Die Frühjahrsdüngung ist vielerorts in vollem Gange. Nach den explodierenden Düngerkosten im letzten Frühjahr hat sich die Situation in diesem Jahr wieder normalisiert. Deshalb gilt es nun umso mehr, die eigenen Grünlandbestände intensiv zu versorgen und bestmöglich für die kommende Futterbau-Saison aufzustellen.
Martin Hoppe, Grünlandberater der Landwirtschaftskammer NRW, gibt Tipps, wie Sie die Frühjahrsdüngung im Grünland bedarfsgerecht und dennoch möglichst effizient und kostensparend organisieren können.
Frühjahrsdüngung nicht unterschätzen!
Eine zeitige Andüngung der Bestände spätestens zum Vegetationsbeginn hat sich im langjährigen Mittel immer als sehr effizient erwiesen. Hinzu kommt, dass die Ertragsleistung und Futterqualität des ersten und zweiten Schnittes in Bezug auf die Gesamtjahresleistung am bedeutsamsten sind. Da die Folgeschnitte meist ertraglich abnehmen, reduziert sich auch der Nährstoffbedarf. Jedoch ist das Ertragspotenzial im Spätsommer extrem witterungsabhängig.
Die uns erwartende Witterung in 2023 ist eine Blackbox.
Martin Hoppe
„Ein Betrieb mit knapper Futterausstattung und geringen Reserven sollte aus der Erfahrung der Trockenjahre 2018 bis 2020 kein Risiko eingehen, indem er bei der Frühjahrsdüngung zum 1. Schnitt spart“, meint Martin Hoppe. Die frühjahrsbetonte Düngung hat sich durch eine bessere Ausnutzung der Winterfeuchtigkeit durch zügiges Wachstum insbesondere in Trockenjahren bewährt. Da niemand die Witterung im kommenden Sommer vorhersagen kann, sollte die Frühjahrsdüngung vor allem für Futter-knappe Betriebe als eine Art Risikoabsicherung angesehen werden.
Gibt es Einsparpotenziale?
Grundsätzlich gilt: Die Schnittflächen zur Silageproduktion haben aufgrund des hohen Nährstoffentzuges einen hohen Düngungsbedarf. Der Bedarf von Weideflächen ist verhältnismäßig gering, da die Weidetiere ca. 80 % der Nährstoffe auf der Fläche belassen. Bei korrekter Düngebedarfsermittlung wird dies berücksichtigt.
Während eine ausreichende Schwefelversorgung auf intensivem Schnittgrünland zum ersten Aufwuchs unbedingt erforderlich ist, um eine ausreichende Proteinbildung sicherzustellen, lässt sich die N-Düngung je nach Ertragspotenzial, Artenzusammensetzung und Grasnarbe durchaus um ca. 20 bis 30 % reduzieren.
Aber Achtung: Wird die N-Düngung im Frühjahr reduziert, wird sich zwangsläufig der Ertrag reduzieren. Der tatsächliche Ertragsrückgang wird allerdings durch die Mineralisierung von organischem Stickstoff, vorhandene Kleeanteile sowie die Witterungsbedingungen beeinflusst. Mittelfristig stellt sich die Grünlandnarbe durch höhere Kleeanteile auf eine deutlich reduzierte N-Düngung ein. In Bezug auf die Futterqualität haben die Artenzusammensetzung der Grünlandnarbe sowie der Schnittzeitpunkt deutlich größeren Einfluss als die N-Düngung.
10 Tipps, was jetzt zu tun ist
Wie sollten Milchkuhhalter nun konkret vorgehen, um ihre Grünlandbestände effektiv und gleichzeitig so effizient wie möglich zu versorgen, ohne dass spätere Grassilagen darunter leiden?
Oberstes Ziel ist, die betriebsinterne, schlagbezogene Pflanzenernährung bestmöglich zu optimieren! In der Praxis gibt es hier oft viele Baustellen.
Martin Hoppe
- Betriebsindividuell handeln: Jeder Betrieb und jeder Pflanzenbestand hat unterschiedliche Ausgangsituationen. Daher ist es so wichtig, alle Maßnahmen den eigenen Bedingungen anzupassen.
- Prüfung der Flächen: Bodenuntersuchungsergebnisse, Kationen-Austauschkapazität sowie die Nährstoffverhältnisse untereinander kritisch prüfen. Gibt es Einzelflächen mit sehr niedrigem pH-Wert oder sehr niedrigen Kaligehalten?
- Defizite beheben: Akuter Kaliummangel im Grünland kann bis zu 40 % Ertrag kosten, sehr niedrige pH-Werte werden zwangsläufig die Verfügbarkeit der Grundnährstoffe einschränken. Diese Defizite müssen behoben und ausgeglichen werden, bevor über den Einsatz von mineralischen N-Düngern nachgedacht wird.
- Wirtschaftsdünger effizient einsetzen: Betriebsinterne Wirtschaftsdünger, die wertvoll und ohnehin vorhanden sind, so effizient wie möglich einsetzen. Das beinhaltet die Nährstoffuntersuchung der Gülle sowie die N-min-Untersuchung der Ackerschläge.
- Wirtschaftsdünger-Verteilung prüfen: Die betriebsinterne Verteilung der Wirtschaftsdünger prüfen! In vielen Futterbaubetrieben wird der Mais zu üppig mit Gülle versorgt, während das intensive Schnittgrünland einen deutlich höheren Bedarf hätte. Eine Umverteilung der Nährstoffkreisläufe kann so Einsparpotenziale von Zukaufdünger schaffen.
- Wirtschaftsdünger-Aufnahme: Die Nährstoffkosten von Wirtschaftsdüngern werden immer geringer ausfallen als beim Einsatz von Mineraldünger. Deshalb sollte man prüfen, ob Wirtschaftsdünger, Gärreste oder Ähnliches von anderen Betrieben aufgenommen werden kann. Achtung: Bei Gärresten darauf achten, dass keine Geflügelexkremente aus Mastbetrieben enthalten sind, wenn diese auf Grünland ausgebracht werden sollen! Weiterhin muss bei der Aufnahme organischer Düngemittel die betriebliche max. N-Grenze von 170 kg/ha im Auge behalten werden, welche durch den N-Anfall aus eigener Tierhaltung und Wirtschaftsdüngeraufnahme nicht überschritten werden darf!
- Düngebedarfsermittlung: Die Düngebedarfsermittlung für jede bewirtschaftete Fläche gibt vor der Düngung die Obergrenze für N und P2O2 vor, um Grünlandbestände mit realistischer Ertragsabschätzung ausreichend zu ernähren. Für die übrigen Nährstoffe gelten die klassischen Düngungsempfehlungen anhand von Bodenuntersuchungen, Nutzungsformen und Erträgen.
- Ertragserfassung: Insbesondere bei der Ertragsabschätzung können grobe Fehleinschätzungen passieren, weil Erträge nicht ermittelt und beispielsweise Bestände mit lückigen Narben so schnell überdüngt werden, während das Ertragspotenzial anderer Schläge mit dichten, leistungsfähigen Narben nicht voll ausgenutzt wird.
- Konsequente Narbenverbesserung: Die konsequente Narbenverbesserung sowie eine teilflächenspezifische Ertragserfassung und Düngung sind besonders wichtige Bausteine für die Effizienzsteigerung!
- N-Verluste reduzieren: Zu einer maximalen N-Effizienz gehört es zwangsläufig auch, jegliche N-Verluste zu minimieren. Verluste bei der Lagerung und der Ausbringung von Wirtschaftsdüngern lassen sich unter anderem durch folgende Maßnahmen reduzieren: Saubere Laufgänge und kühles Stallklima; Belassen von Schwimmschichten während der Lagerung zur Vermeidung von Ammoniakemissionen; Einsatz von Güllezusatzstoffen bzw. Ansäuerung zur Emissionsreduktion; kurz vor der Ausbringung gut homogenisieren, separieren oder Wasser zusetzen (Ziel: Gülle max. 6 % TS); Ausbringung bei bedecktem, kühlem Wetter mit möglichst bodennaher Ausbringung wie Schleppschuh oder Gülledrill.
Weitere Artikel:
Bodennahe Gülleausbringung
Sechs Tipps dazu, wie sich eine Futterverschmutzung bei der Bandablage von Gülle verhindern lässt.
Die Art und Weise, wie Gräser genutzt werden, beeinflusst ihre Leistung. Ein früher erster Schnitt führt etwa auch zu höheren Zuwachsraten im zweiten Aufwuchs.
Seit 2012 kauft Cord Lilie keinen mineralischen Dünger mehr zu. Er erklärt wie konventioneller Futterbau mit eigenem Wirtschaftsdünger und Leguminosen gelingt.