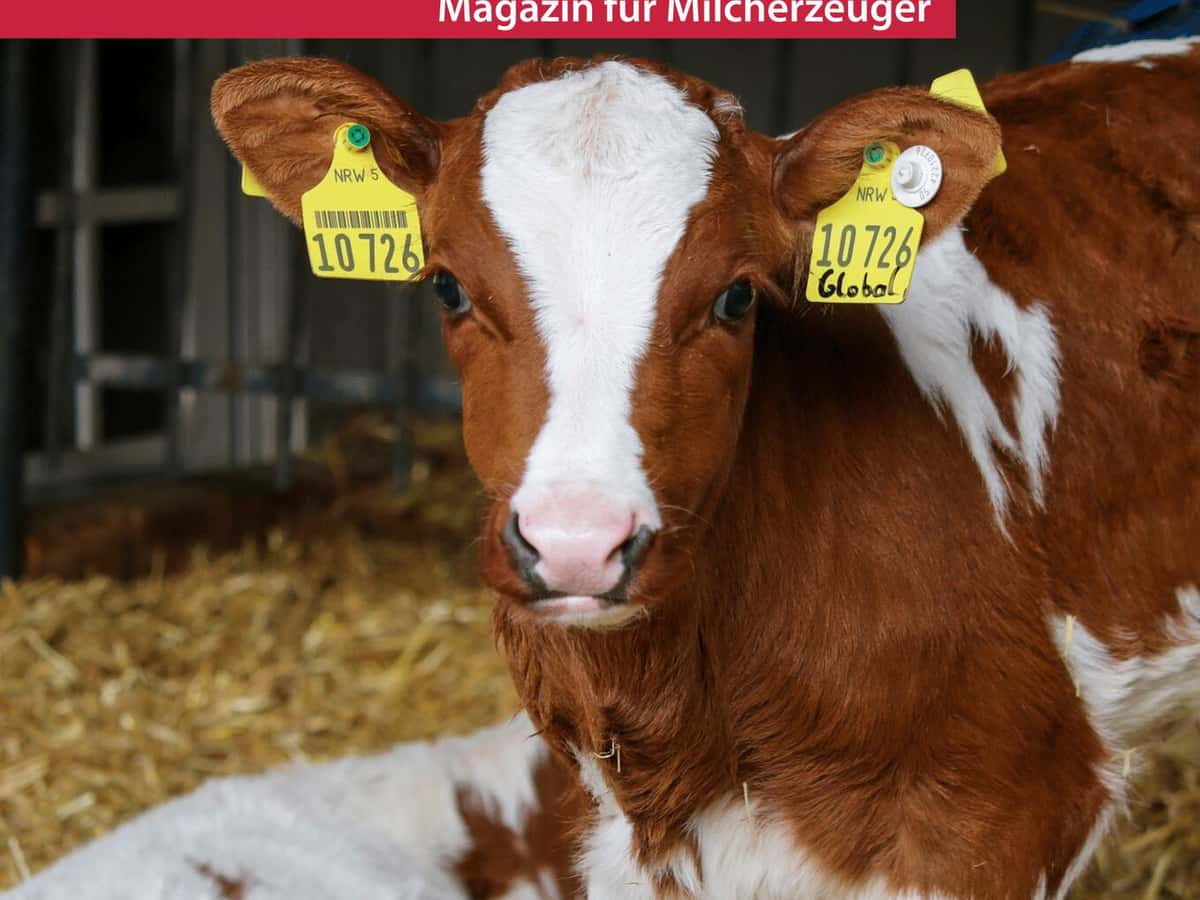Die Eutergesundheit wird zu ca. 30 % von der Melkroutine beeinflusst. Das heißt im Umkehrschluss: Eine optimale Melkroutine kann die Eutergesundheit nachhaltig verbessern.
Ist das Euter ausreichend stimuliert?
Die Milch im Euter besteht aus Zisternen- und Alveolarmilch. Die Zisternenmilch sammelt sich in Hohlräumen. Sie ist jederzeit verfügbar. Die Alveolarmilch hingegen ist im Drüsengewebe fixiert. Sie steht für den Milchentzug erst dann zur Verfügung, wenn sich die Alveolen...
Die Eutergesundheit wird zu ca. 30 % von der Melkroutine beeinflusst. Das heißt im Umkehrschluss: Eine optimale Melkroutine kann die Eutergesundheit nachhaltig verbessern.
Ist das Euter ausreichend stimuliert?
Die Milch im Euter besteht aus Zisternen- und Alveolarmilch. Die Zisternenmilch sammelt sich in Hohlräumen. Sie ist jederzeit verfügbar. Die Alveolarmilch hingegen ist im Drüsengewebe fixiert. Sie steht für den Milchentzug erst dann zur Verfügung, wenn sich die Alveolen durch die Wirkung des Hormons Oxytocin (Anrüsten) kontrahieren.
- Anrüstdauer: Von der ersten Berührung des Euters bis zum Ansetzen sollen deshalb mind. 60 Sek. (zweimal Melken/Tag) bzw. 90 Sek. (dreimal Melken/Tag) liegen. Dann erst wird Alveolarmilch freigesetzt. Nach 120 Sek. lässt der Oxytocin-Reiz bereits wieder nach und der Milcheinschuss versiegt. Eine zu kurze oder lange Anrüstzeit führt damit zum Blindmelken. Das belastet die Zitzen und führt zu einer längeren Melkdauer. Deshalb sollte diese Dauer z. B. mit der Stoppuhr überprüft werden. Neuere Melktechnik stimuliert die Zitzen. Diese Zeit muss einkalkuliert werden.
- Anrüsterfolg: Als Kontrollgröße wird u. a. der Milchfluss in den ersten zwei Melkminuten empfohlen. Dabei gilt es ca. 50 % der Gesamtmilchmenge in dieser Zeitspanne auszumelken. Aber: Die Menge der Zisternenmilch fällt bei den Kühen unterschiedlich aus. Daher macht es Sinn, auch die Milchflusskurven (Lacto-Corder-Messung) bzw. den Milchfluss über die Schaugläser zu beurteilen. Dabei sollte kein massives Einbrechen (fehlender Nachfluss von Alveolarmilch) der Milchflusskurve zu sehen sein.
Papiertest: Passt die Reinigung?
Das Ziel der Zitzenreinigung vor dem Melken sind saubere und trockene Zitzen. Wichtig ist die Sauberkeit der Zitzen vor dem Ansetzen der Melkzeuge zu kontrollieren. Dafür eignet sich der „Papiertest“.
- Sie nehmen ein Desinfektionstuch und tupfen von unten die Zitzenkuppe nach dem Vorreinigen ab. Sind keine Spuren auf dem Papier zu erkennen, ist die Zitze sauber.
- Max. 5 von 20 Zitzen dürfen Spuren auf dem Papier hinterlassen. Sonst müssen sie besser gereinigt werden.
- Um feststellen zu können, ob die Zitzen nach dem Vorreinigen nicht zu nass sind, eignet sich für das Betupfen auch ein handelsübliches Küchentuch.
Je nach Eutergesundheitsstatus kann der Einsatz von Reinigungsschaum (Predippmittel) sinnvoll sein. Kontrollpunkt: Das Predippmittel muss mind. 30 Sek. einwirken, um seine volle bakterielle Wirkung entfalten zu können.
Was man nach der Melkzeugabnahme kontrollieren sollte…
Ausmelkgrad: Bei Melkständen mit Abnahmeautomatik erledigt die Technik das Abnehmen der Melkzeuge. Wenn Sie Bedenken haben, ob die Abnahmeautomatik richtig funktioniert, lassen Sie die einprogrammierte Abnahmeschwelle kontrollieren oder versuchen Sie bei eutergesunden Kühen nach der Melkzeug-Abnahme drei bis vier satte Milchstrahlen (!) zu ermelken. Bei zwei und weniger oder fünf und mehr Strahlen, sollte die Technik überprüft werden. Zusätzlich deuten kaum eingefallene oder noch relativ fest gebliebene Euterviertel auf unvollständigen Milchentzug hin.
Dippmittel: Sie sollten, um ihre Wirkung entfalten zu können, direkt nach dem Melken aufgetragen werden und dabei die unteren zwei Drittel der Zitze vollständig benetzen.
Zitzenkondition zeigt Fehler
Ein Indikator, der Rückschlüsse auf die Melktechnik gibt, ist die Verfassung der Zitzen (Zitzenkondition) unmittelbar nach der Melkzeugabnahme. Verfärbungen (rot bis violett), Einschnürungen (weiße Ringe) am Zitzenschaft und an der Zitzenbasis, Blutungen (punktförmig oder größer), Ödeme (Schwellung durch Einlagerung von Blut, Lymphe und Gewebeflüssigkeit) und Hyperkeratosen an der Zitzenkanalöffnung weisen auf eine falsch eingestellte Melktechnik, eine zu kurze Anrüstzeit oder unpassende Zitzengummidurchmesser hin.
Fallen Zitzenveränderungen auf, sollte die Technik (Melkvakuum, Taktung, …) und das Anrüsten bzw. Vorreinigen (zu feuchte Zitzen, das Melkzeug klettert) kontrolliert werden.
In Zusammenarbeit mit Johanna Mandl, Landwirtschaftskammer Niederösterreich
Hier finden Sie weitere interessante
Artikel zum Thema Melken:
- Die Melkzeit kürzer halten: Nachlässigkeit im Melkprozess schlagen sich in einer schlechteren Eutergesundheit, geringeren Milchleistung und Milchqualität nieder. Tipps, wie Sie den Melkprozesses verbessern können.
- Vorsicht: Oxytocin macht abhängig! Bei Milch-Ejektionsstörungen ist Stress die häufigste Ursache. Die Milch lässt sich oft auch ohne künstliche Hormone aus dem Euter locken. Ein paar Tipps.
- Gesunde Zitzen im Winter: Wenn die Temperaturen sinken, besteht die Gefahr, dass die Zitzen nachhaltige Kälteschäden erleiden. Tipps, wie das zu verhindern ist.