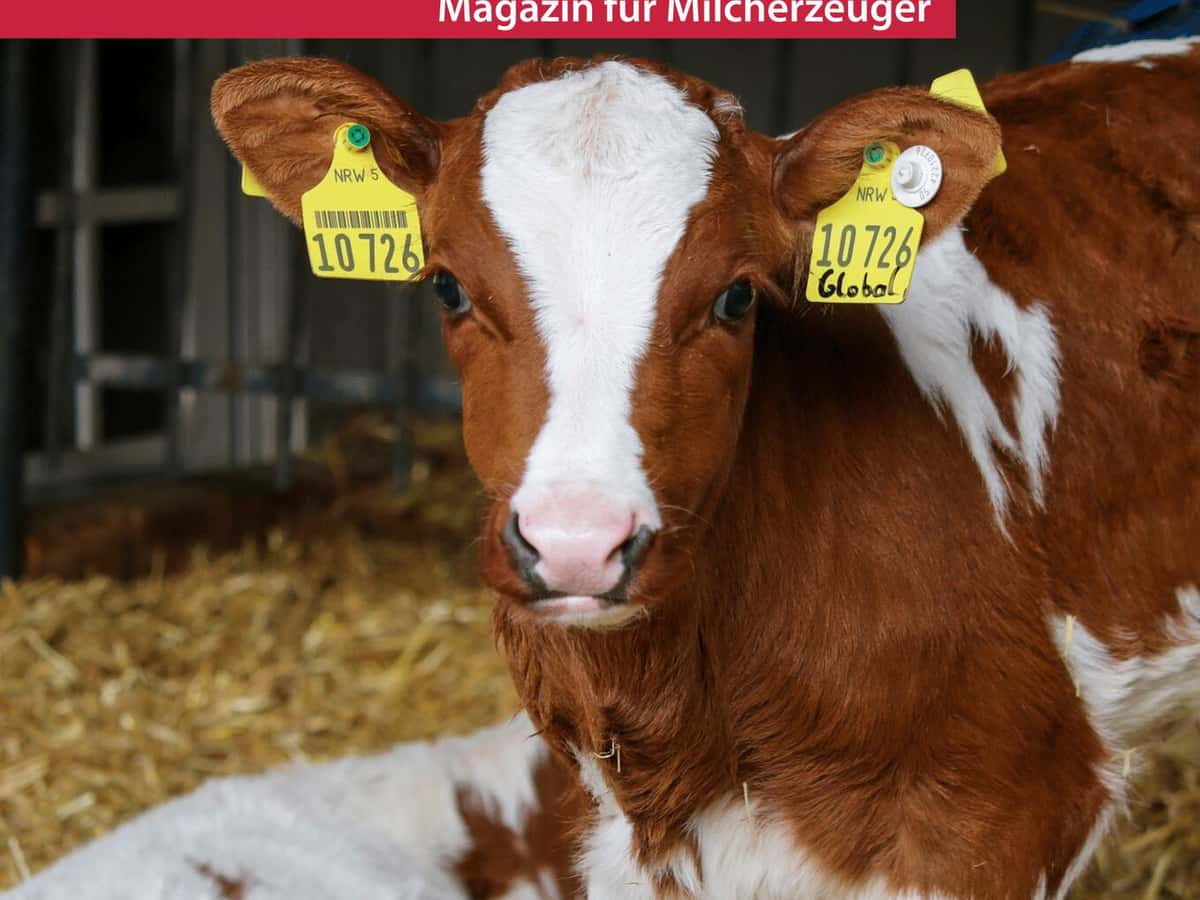KOMPAKT
- Viele Verbraucher lehnen eine frühe Trennung von Kuh und Kalb ab. Zur Absicherung ihrer gesellschaftlichen Akzeptanz sollte die Milchbranche in diesem Punkt Lösungen entwickeln.
- Eine Möglichkeit, sich etwas aus dem Kälber-Dilemma zu befreien, wäre, die Anzahl an Abkalbungen zu reduzieren.
- Eine Ausdehnung der Laktation (weniger Geburten, weniger Kälber) ist grundsätzlich möglich. Voraussetzung dafür ist eine sehr hohe Milchleistung, gepaart mit einer flachen Laktationskurve.
Gefragt sind Marathonkühe, keine Sprinterkühe!
Wir müssen reden! Über Kälber bzw. über deren Aufzucht! Warum? Der Umgang mit den neugeborenen Kälbern bzw. deren „Anschlussverwertung“ könnte sich in den kommenden Jahren zu einem Tsunami auswachsen, der über die Milchbranche hinwegrollt! Das glauben Sie nicht? Beim Tierwohl kochen die Emotionen in der Öffentlichkeit oft richtig hoch. Für Kritik sorgen besonders …
- die frühe Trennung von Kuh und Kalb
- die Tiertransporte (Zuchtrinder)
Trennung von Kuh und Kalb nicht akzeptiert
Auch wenn für die frühe Trennung von Milchkuh und Kalb gute Gründe sprechen, stehen viele Verbraucher dieser Praxis äußerst kritisch gegenüber, denn die ersten gemeinsamen Tage sind bei den Menschen prägend für die Beziehung zwischen Mutter und Kind. Dieser Umgang mit dem eigenen Nachwuchs wird auch gerne auf die Tierwelt übertragen. Aus einer von der Universität Göttingen und der University of British Columbia durchgeführten Studie geht hervor, dass 83 % der Befragten eine frühe Trennung von Mutter und Kalb ablehnen bzw. eine späte(re) Trennung befürworten.
Selbst nachdem die Befragten darüber aufgeklärt wurden, dass bei einer frühen Trennung noch kein ausgeprägter Trennungsschmerz zu beobachten ist und dass der Stress umso größer ist, je später die Trennung erfolgt, änderten die meisten Befragten ihre Meinungen nicht. Aufgrund der öffentlichen Ablehnung der gängigen Praxis empfehlen die Wissenschaftler, sich Gedanken um neue Verfahren zu machen, die zu einer nachhaltigen gesellschaftlichen Akzeptanz der Milchkuhhaltung führen.
Wohin mit den vielen Kälbern?
Eine Lösung könnte eine Kombination einer deutlichen Verlängerung der Laktation (weniger Abkalbungen) und einer muttergebundenen oder Ammen-Aufzucht darstellen. Je weniger Kälber geboren werden, desto einfacher wird die Implementierung eines solchen Aufzuchtsystems. Auch wenn Sie diese „Vision“ als ziemlich absurd erachten, so ist doch nicht zu leugnen, dass Milchproduzenten, die auf reine Milchrassen setzen, neue Strategien zur „Verwertung“ ihrer Kälber finden müssen.
Glücklicherweise nimmt die Kälbermast in Deutschland jährlich noch rund 330.000 (Holstein-)Kälber auf. Weitere 630.000 Kälber werden aus Deutschland zur Ausmast in die Niederlande verbracht. Gar nicht auszudenken, wenn dieses Mastverfahren wegen angeblicher Tierwohl-Defizite beim Verbraucher oder beim Gesetzgeber in Ungnade fällt. Dann wären eine Million Kälber in den deutschen Kuhställen „über“.
Unsichere Aussichten bezüglich Export und Fleischkonsum
Wie schnell der Kälbermarkt zu kippen vermag, ist aktuell zu beobachten. Aufgrund der Corona-Pandemie sind die Kälber und Rinderexporte weitgehend zum Erliegen gekommen. Die Kälber von Milchrassen kosten fast nichts mehr. In manchen Regionen „drohen“ Viehhändler schon damit, Holsteinkälber gar nicht mehr einzusammeln. Etwas entspannter können Milcherzeuger in die Zukunft schauen, die auf eine Doppelnutzungsrasse wie Fleckvieh setzen. Die weiblichen Kälber lassen sich zumeist noch zu passablen Konditionen vermarkten, die Bullenkälber sind ohnehin bei den Mästern gefragt.
Doch in Sicherheit wägen sollten sich auch die Fleckviehhalter nicht, denn der Fleischkonsum scheint in den Ländern des Westens seinen Höhepunkt erreicht zu haben. Der Konsum stagniert, nicht zuletzt auch, weil die Kritik an der Rindfleischproduktion zunimmt. Zwar werden nicht über Nacht alle jungen Leute zu Verganern mutieren, es ist jedoch davon auszugehen, dass etliche von ihnen künftig weniger Fleisch konsumieren werden als ihre Eltern.
Nur noch alle 2,5 Jahre kalben lassen?
Wie gesagt, eine Möglichkeit, sich etwas aus dem Kälber-Dilemma zu befreien, wäre die Anzahl der Abkalbungen zu reduzieren. So würden weniger Kälber geboren. Das mag verrückt klingen, denn wenn eine Kuh nicht regelmäßig abkalbt, versiegt ja irgendwann die Milch. Stimmt, aber viele Holsteinkühe geben nach 350 Laktationstagen noch sehr viel Milch, nicht selten sogar noch 30 Liter täglich. Warum sollte man bei einer solchen Milchleistung eine Kuh trockenstellen?
Unterstellen wir mal, dass in den kommenden Jahren der Zuchtfortschritt dank Genomics weiter zunimmt, dann werden wir wahrscheinlich demnächst unsere Kühe mit 35 oder sogar 40 Litern trockenstellen müssen. Das wird einige Probleme nach sich ziehen, nicht nur beim Trockenstellen, denn derart hohe Milchleistungen erfordern insbesondere zu Laktationsbeginn sehr hohe Stoffwechselleistungen. Ein Organismus, der permanent auf Hochtouren läuft, ist anfälliger für jegliche Störungen.
Vor dem Hintergrund der hohen Milchleistungen macht es schon einen Unterschied, ob z.B. innerhalb einer Fünfjahresperiode die Kuh fünf Mal oder nur zwei Mal der Herausforderung Abkalbung und Laktationsstart ausgesetzt wird. Letztlich zählt doch die absolute Milchmenge. Wenn eine Kuhe sehr gut melkt, warum also sollte sie dann nach 400 Tagen wieder abkalben? Warum nicht erst nach 912 Tagen (2,5 Jahren) wieder abkalben lassen – immer vorausgesetzt, sie gibt am Ende dieser langen Laktation noch 15 kg Milch?
Weniger Stress für Kuh und Mensch
Eine deutliche Ausdehnung der Laktation kann Vorteile mit sich bringen:
- Kühe mit höherer Milchleistung brauchen eine längere Laktation, da der Zyklus später einsetzt. In einer Studie wurden beispielsweise bei einer Rastzeit von 180 Tagen deutlich weniger Kühe mit inaktiven Eierstöcken gefunden (Nioziaset et al., 2019).
- Weniger Abkalbungen bedeuten weniger Stress für die Kuh und den Herdenbetreuer.
- Weniger Abkalbungen bedeuten weniger frischlaktierende Kühe und damit weniger Erkrankungen und deshalb wahrscheinlich auch geringere Remontierungsraten.
- Weniger Abkalbungen bedeuten letztlich aber auch weniger Kälber, die aufgezogen und vermarktet werden müssen!
Täglich 29,5 kg Milch über 30 Monate
Natürlich sind mit der Ausdehnung der Laktation auch Risiken verbunden. Die Milchleistung könnte sich z.B. deutlich verringern. Im Gegenzug würden dann die Produktionskosten in die Höhe schnellen. Bislang liegen noch keine Erfahrungen mit langen Laktationszyklen vor. In einigen wenigen Praxisstudien wurde aber immerhin schon mal die freiwillige Wartezeit auf bis zu 180 Tage verlängert. Die Kühe wurden also rund 100 bis 120 Tage später besamt.
Es stellte sich heraus, dass der Aufwand für eine Trächtigkeit bei der Verlängerung der freiwilligen Wartezeit auf bis zu 180 age drastisch gesunken ist. Viele Kühe, denen eine Repro-Pause zugestanden wurde, sind später quasi ohne Hilfe (Ov-Synch) tragend geworden. Auch führte eine Verlängerung der Laktationsdauer nicht zwingend zu einer Verfettung der Kühe. Bleibt die Frage, ob ein solches Repro-System unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten besser abschneiden kann?
Bleiben wir bei der visionären Variante von nur zwei Abkalbungen innerhalb einer fünfjährigen Nutzungsperiode. Unterstellen wir auch, dass die Jahresmilchleistung nicht geringer ausfallen darf als im herkömmlichen System mit fünf Abkalbungen, bei dem an insgesamt 1.573 Laktationstagen rund 51.900 kg Milch gemolken werden. Dann müssten in jeder der beiden 30 Monate langen Laktationen etwa 25.950 kg gemolken werden. Umgerechnet 29,5 kg Milch täglich! Das ist gar nicht so abwegig, die Kühe müssten nur die Milch über einen langen Zeitraum halten.
Flache Laktationskurven wären nötig
Die Krux ist jedoch, dass die Kühe auf maximale Peakleistungen gezüchtet werden, nicht auf flache Laktationskurven. Hier müsste ein radikales Umdenken erfolgen, denn lange Laktationen erfordern eine möglichst gleichbleibende Milchleistungskurve, eine maximale Persistenz. Marathonkühe anstatt Sprinterkühe! Gelingt es, die Kühe genetisch derart „umzuprogrammieren“, dann würden auch keine Milchleistungen von 70 kg und mehr in der Spitze anfallen.
Obwohl eine „flache Laktationskurve“ bzw. eine hohe Persistenz von zunehmend mehr Züchtern nachgefragt wird, haben sich die Zuchtorganisationen bislang kaum mit diesem Merkmal beschäftigt. In Kanada wird ein entsprechender Zuchtwert für Holsteins berechnet, der aber nicht in den Gesamtzuchtwert einfließt. In Deutschland ist laut Auskunft des VIT ein Zuchtwert in Arbeit, es ist aber noch nicht absehbar, wann es ihn geben wird.
Hingegen gibt es bei Braunvieh und Fleckvieh schon seit rund 15 Jahren einen Persistenz-Zuchtwert, der aber auch nur zu drei Prozent im Gesamtzuchtwert enthalten ist. Vermutlich findet das Merkmal bei Fleckvieh aufgrund der vergleichsweise hohen Kälberpreise in der Praxis ebenso wenig Bedeutung wie die Diskussion um eine Verlängerung der Laktation.
Übersicht 1: Verschiedene Laktationskurven
Ohne gesextes Sperma geht‘s nicht
Zu bedenken ist auch, dass im Fall einer Verlängerung der Laktation auf 30 Monate (2,5 Jahre) zu wenige Kälber geboren werden. Immerhin müssen selbst bei einem sehr guten Herdenmanagement (20% Remontierung) jährlich pro 100 Kühe, 20 Färsen nachgeschoben werden. Mit einer geringeren Remontierungsrate sollte nicht gerechnet werden, da sonst der Zuchtfortschritt ausbleibt.
Wenn jede Kuh im Lauf ihres produktiven Lebens (Nutzungszeitraum von fünf Jahren) nur noch zwei Kälber zur Welt bringt, dann fallen pro 100 Kühe genau 20 weibliche Kälber an. Allerdings dürfen dann in der Aufzucht keine Verluste mehr auftreten. Das zu unterstellen ist aber blauäugig, deshalb führt am Einsatz von weiblich gesextem Sperma bei einer Verlängerung der Laktation wohl kein Weg vorbei.
Bleibt festzuhalten:
Eine deutliche Verlängerung der Laktation würde etwas den Druck aus dem Kessel nehmen, da weniger Abkalbungen und damit auch weniger Kälber anfallen, die aufgezogen werden müssen. Hinzu kommt, dass mit jeder entfallenen Kalbung ein Stressor entfällt. Das wiederum könnte sich positiv auf die Tiergesundheit und Nutzungsdauer auswirken.
Mehr Milch und weniger Kälber durch verlängerte Laktationen! Milcherzeuger Herbert Te Selle zeigt, dass das auch ohne flache Laktationskurven funktioniert.