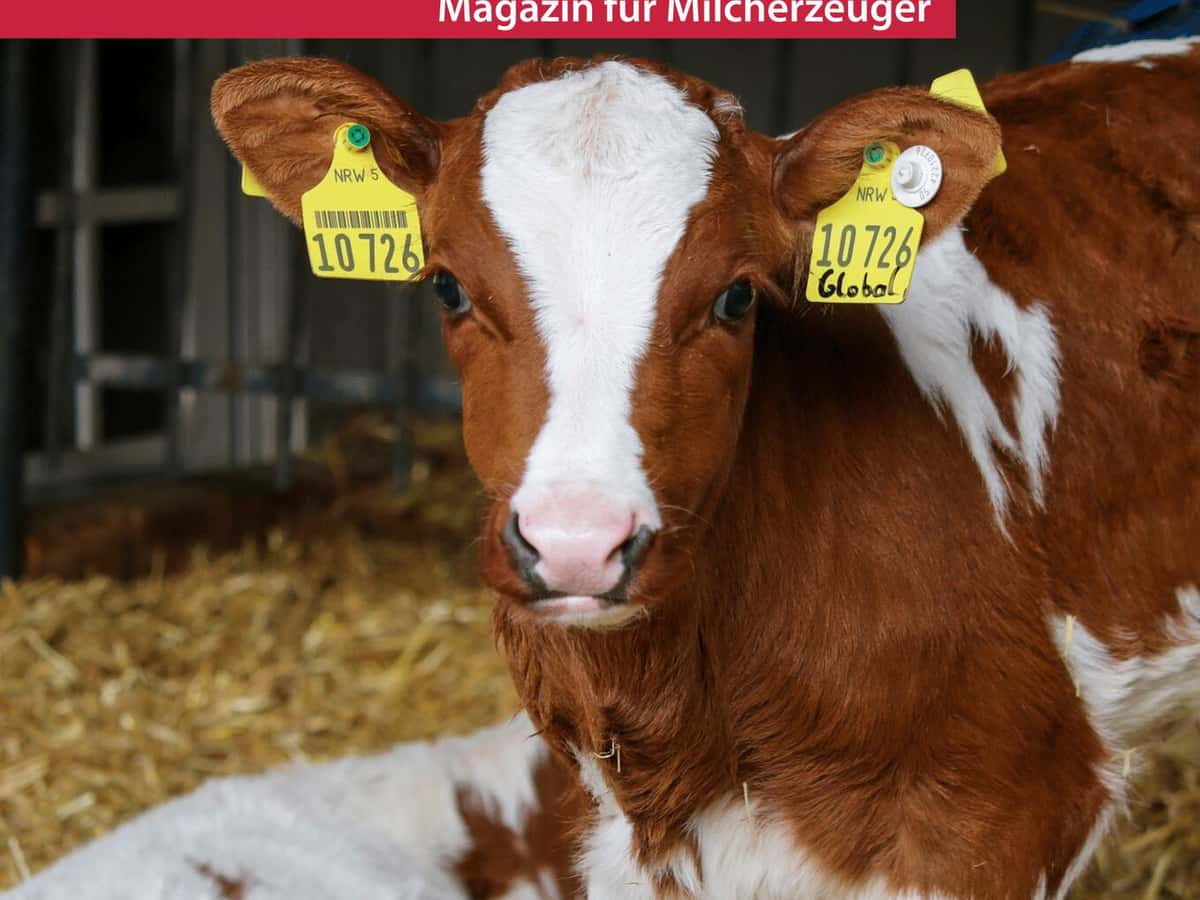Das haben wir immer schon so gemacht“, diese Aussage passt künftig nicht mehr zum Futterbau. Denn selbst, wenn die globale Erwärmung, wie vom Pariser Klimaschutzabkommen festgelegt, nur bei 1,5 °C bleiben sollte, werden eine verringerte Wasserverfügbarkeit in der Vegetationsperiode, aber auch vermehrte Starkregenereignisse den Anbau massiv beeinflussen.
An diese Rahmenbedingungen muss der Futterbau...
Das haben wir immer schon so gemacht“, diese Aussage passt künftig nicht mehr zum Futterbau. Denn selbst, wenn die globale Erwärmung, wie vom Pariser Klimaschutzabkommen festgelegt, nur bei 1,5 °C bleiben sollte, werden eine verringerte Wasserverfügbarkeit in der Vegetationsperiode, aber auch vermehrte Starkregenereignisse den Anbau massiv beeinflussen.
An diese Rahmenbedingungen muss der Futterbau angepasst werden, um das Risiko verminderter (Silage-)Qualitäten, aber vor allem verheerender Futterausfälle zu reduzieren. „Ertragsschwankungen, vor allem im Grünland, werden zunehmen. Neben den Erträgen können auch die Futterqualitäten zwischen den Schnitten stärker als bisher schwanken“, so Dr. Gerhard Riehl, LfULG Sachsen.
Bei grobfutterdominierter Fütterung trifft dies besonders Herden mit bisher hoher bis sehr hoher Leistung. Für eine langfristig rentable Milcherzeugung wird daher mehr Wissen über den Anbau und den eigenen Standort erforderlich sein als jemals zuvor. Generell wird der Anteil an intensiven Futterbau-Systemen zurückgehen. Möglichst sichere (Masse-)Erträge sind das Ziel, die man u. a. durch eine breitere Arten- und Sortenwahl (Risikostreuung) erreicht.
Ertragsschwankungen, vor allem im Grünland, werden zunehmen
Dr. Gerhard Riehl, LfULG Sachsen
„Um Erfahrungen zu sammeln, ist es wichtig, dass die Betriebe kleinflächig neue Anbaustrategien ausprobieren, bevor flächendeckend etwas angebaut wird, dass man am Ende nicht mehr ‚beherrschen‘ kann“, erklärt Katharina Weihrauch, LLH Hessen.
Trockenheitstolerantere Sorten und Arten
Um das Dauergrünland breiter aufzustellen, gelten folgende Empfehlungen:
- Trockentoleranz und Resilienz (Fähigkeit zur Regeneration) der Bestände müssen künftig noch stärker in den Fokus rücken.
- Das Risiko lässt sich auch über die Anlage von stabilen Mischbeständen aus Gräsern, Leguminosen sowie gegebenenfalls Kräutern die robuster gegen Wetterextreme sind, streuen.
- Eine weitere Anpassungsmöglichkeit ist eine größere Variation bei den Reifegruppen der Saatmischungen. Sommertrockene Standorte sollten auf frühere Sorten setzen, um mit dem ersten und (in Teilen) dem zweiten Schnitt möglichst viel Futter mit höchstmöglicher Qualität zu ernten. Damit die Winterfeuchte effektiv genutzt wird, ist ein wirklich früher Schnitt notwendig. Dann bleibt oft ausreichend Wasser für den zweiten Aufwuchs.
- Das Grünlandmanagement muss hinsichtlich Schnittzeitpunkt, -höhe (nie kürzer als 7 bis 8 cm) und Nährstoffversorgung flexibel angepasst werden. Bestände während Dürrephasen nicht „abrasieren“, da sie ansonsten leiden.
- Bei Weidegang immer auf die Schonung der Stoppelzone (Verbisstiefe!) achten. Zufütterung und entsprechende Grobfuttermengen/Futterreserven einplanen.
Um Erfahrungen zu sammeln, ist es wichtig, dass die Betriebe kleinflächig neue Anbaustrategien ausprobieren
Katharina Weihrauch, LLH Hessen
Die Sortenwahl anpassen
Trockentoleranz und Resilienz im Dauergrünland werden wichtiger. Welche Gräser können eingesetzt werden?
- Das Deutsche Weidelgras reagiert schnell positiv auf wiederkehrende Feuchte, auch nach längerer Trockenheit. Auf sommertrockenen Standorten sollten keine reinen Weidelgras-Mischungen bei der Neu- oder Nachansaat verwendet werden.
- Auch Wiesenrispe, Wiesenschwingel oder Wiesenschweidel sind wertvolle Bestandsbegleiter, besonders bei Grünlandneuanlagen. Wiesenrispe füllt Lücken aufgrund der Ausläuferbildung sehr gut, zeichnet sich aber durch eine langsame Jugendentwicklung aus. Wiesenschweidel zeigte in den letzten Trockenjahren Potenzial, muss aber hinsichtlich Ausdauer, besonders in Mittelgebirgslage, weiter geprüft werden.
- Wiesenlieschgras etabliert sich gerne in Beständen, in denen sich die konkurrenzstarken Hauptbestandsbildner aufgrund von regelmäßig auftretenden Trockenperioden zurückziehen.
- Knaulgras ist sehr gut für trockene bzw. sandige Standorte geeignet, auf denen das Dt. Weidelgras nur eine geringe oder keine Chance hat. Das Gleiche gilt für Rohrschwingel. Knaulgras und Rohrschwingel haben nur eine geringe Nutzungselastizität, so dass oft nicht alle Flächen zum optimalen Zeitpunkt geschnitten werden.
Der Frühkauf für den Mais 2023 ist in vollem Gange. Was bietet der Markt und worauf sollten Sie nach dem letzten Dürrejahr jetzt besonders achten?
Ackerfutter: Fehler schneller ausmerzen
Für den Ackerfutterbau gilt: Hier wirken Fehler nicht so lange nach wie im Dauergrünland, da mit dem Kulturwechsel Fehlentwicklungen schneller rückgängig gemacht werden können. Beim Ackerfutter sollte man stärker auf Leguminosen-Gras-Gemenge (Kleegras, Luzernegras) anstatt auf reine Feldgrasbestände setzen. Auch hier kann der Anbau (standortabhängig) von robusteren Mischungen z.B. mit Knaulgras oder Rohschwingel Sinn machen. Beide Grasarten empfehlen sich jedoch nur auf Standorten, auf denen Deutsches Weidelgras und Wiesenschwingel keine Chance haben!
Feinleguminosen sichern den Ertrag
Luzerne und Rotklee kommen mit Trockenheit besser zurecht als Futtergräser und sind im Ackerfutterbau reinsaattauglich. Luzerne ist im Dauergrünland nur schwer zu etablieren und funktioniert hier eher bei extensiver Nutzung mit zwei bis drei Schnitten auf Trockenlagen mit ausreichendem Boden-pH und gut durchlüfteten Böden. Ein Zumischen von Rotklee kann im Dauergrünland deutliche Mehrerträge und in späteren Trockenphasen stabilere Erträge bringen. Auf sommertrockenen Standorten können 2 – 4 kg/ha Rotklee (z.B. nach dem 3. Schnitt) allein nachgesät werden (>15% Lücken) oder bei sehr großer Lückigkeit einer weidelgrasdominierten Nachsaatmischung zugegeben werden. Wichtig ist nachfolgend eine reduzierte N-Düngung.
Kombination mit Kräutern anbauen?
Seit einigen Jahren wird über den Einsatz von Kräutern wie Spitzwegerich, Wiesenkümmel oder Futterzichorie geforscht. Ergebnisse zeigen, dass z.B. eine Kombination aus Leguminosen (N-Fixierung), Kräutern (tiefe Wurzel) und Gras (flache Wurzel) eine hohe Trockenheitstoleranz erzielt (Grünlandmischbestände).
Entsprechend sollten Sorten mit unterschiedlichen Blühterminen gewählt werden
Norbert Erhardt, LWK NRW
In Jahren mit normalen Zuwachsphasen der Gräser ist die Etablierung von Kräutern aber schwierig. Zudem gibt es bisher keine beschreibende Sortenliste und erste Sorten-Screenings ergaben extreme Unterschiede bei TM-Ertrag und der Abreife. Die Nachsaat von Futterzichorie oder Spitzwegerich funktioniert, aber sie können nur zu einer Verbesserung der Futterqualität bzw. der Ertragsstabilität bei Weidegang oder Frischfütterung beitragen.
Vor ein paar Jahren wurde der Anbau von Mais im Gemenge mit Stangenbohnen propagiert. Ziel war auch, den Proteingehalt in den Silagen zu erhöhen. Ist das gelungen?
Mais: Reifespektrum anpassen
Den größten negativen Einfluss auf Ertrag und Qualität von Mais hat Trockenstress zwischen dem Rispenschieben und beginnender Kornbildung. „Entsprechend sollten Sorten mit unterschiedlichen Blühterminen gewählt werden“, so Norbert Erhardt, LWK NRW.
Hartmaisbetonte Sorten blühen früher als Sorten mit hohen Zahnmaisanteilen. In den Trockenjahren ab 2018 kamen tendenziell frühe bzw. früh blühende Sorten besser klar, weil diese Sorten mehr Zeit für Korn- bzw. Kolbenfüllung hatten. Neben der Sortenwahl ist auch eine an den Standort angepasste Produktionstechnik wichtig. Der Mais muss die Wasserreserven des Standorts optimal nutzen können. Das gelingt nur, wenn wassersparend geackert wird und darüber hinaus gewährleistet ist, dass der Mais ungehindert wurzeln kann (keine Bodenverdichtung). Entscheidend ist ebenso die sorten- und standortspezifische Bestandesdichte. Auf Standorten mit häufigen Trockenschäden reichen bei großrahmigen Sorten sechs Pflanzen/m2. Kleinrahmige, kompakte Sorten dürfen etwas dichter stehen.
Hirse als Alternative
Der Anbau von Hirse könnte (in Teilen) eine Alternative zu Mais sein, wenn dieser wegen zunehmender, extremer Trockenheit gänzlich ausfallen sollte. Denn Hirsen nutzen aufgrund ihres tiefreichenden Wurzelsystems Wasser und Nährstoffe gut aus und sind in sehr extrem trockenen Jahren ertragsstabiler. Für die Tierernährung können massenwüchsige Futterhirsen und kurze, kompakte Körnerhirsen als Silomaisersatz passend sein. Allerdings ist die stärkerreichere Körnerhirse kleinwüchsig, die Futterhirse zeigt dafür eine schlechtere Faserverdaulichkeit. Achtung: Hirsepflanzen neigen dazu unter Stress zu viel Blausäure zu bilden. Werden die Höchstgehalte (57 mg je kg Trockenmasse) überschritten, darf die Hirse nicht verfüttert werden. Durch die Silierung wird jedoch ein Teil der Blausäure abgebaut.
Das Einbringen von Rot- und Weißklee in Grasnarben ist eine Möglichkeit, Stickstoffdünger einzusparen. Tipps, wie die Etablierung gelingt.