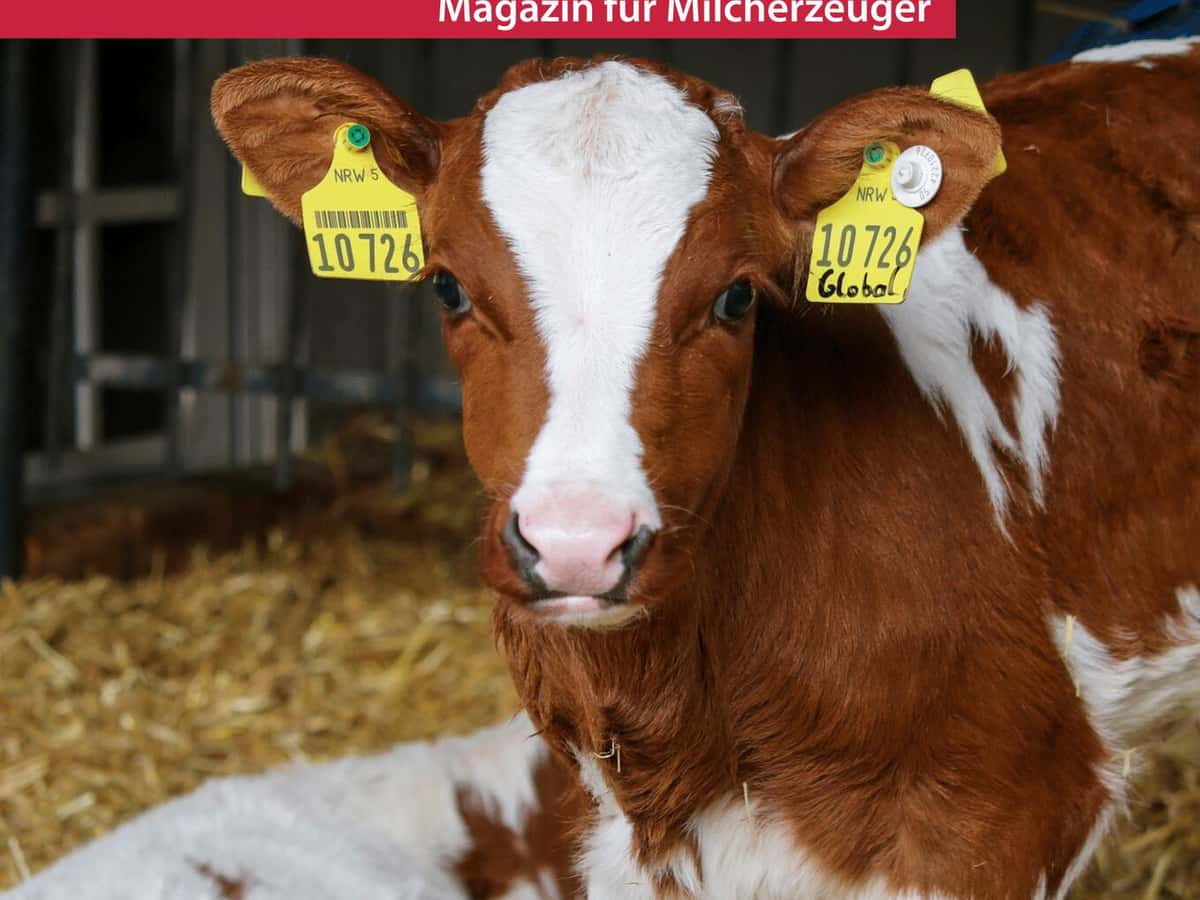Weist eine Herde eine schlechte Fruchtbarkeit auf, ist nicht selten eine geringe Brunstnutzungsrate (bzw. Brunsterkennungsrate) nach der freiwilligen Wartezeit die Ursache. Ein Grund dafür ist, dass Brunsten oft gar nicht erst erkannt werden. Sei es, weil eine Stillbrunst vorliegt, aber auch, weil die Intensität und Dauer der Hauptbrunst bei hochleistenden Kühen (> 40 kg/Tag) deutlich kürzer ausfällt als bei Kühen mit einer geringeren Leistung (6,4 vs.11,9 Stunden).
Die exakte Brunsterkennung gewinnt mit steigenden Leistungen deshalb weiter an Bedeutung. Denn es ist für das Management der Herde wichtig, dass die durchschnittliche Rastzeit, ganz gleich, ob der Milcherzeuger eine kürzere oder längere freiwillige Wartezeit wählt, nur eine geringe Streuung (Variation) aufweist. Nur so kann man sicherstellen, dass der Laktationsstand der Herde (durchschnittlicher Laktationstag) auf einem stabilen Niveau verbleibt. Mangelt es an einer effektiven Brunsterkennung, sind zwei Wege möglich: Die Brunstbeobachtung intensivieren oder auf Hilfsmittel (z. B. Schwanzkreide, Brunsterkennungssysteme, Hormonprogramm) zurückgreifen.
Alles im Blick
Der Erfolg der visuellen Brunsterkennung wird maßgeblich von der Tageszeit, Beobachtungsdauer sowie -häufigkeit beeinflusst. Wichtig ist es, die Tiere in der Vorbrunst zu erkennen, den Verlauf zu beobachten und den richtigen Besamungszeitpunkt festzulegen. Tageszeiten, die für die Brunstbeobachtung ideal sind:
- Morgens zwischen 5.00 und 7.00 Uhr vor der Melkzeit,
- in der Mittagszeit,
- abends zwischen 17.00 und 19.00 Uhr und
- spät abends, wenn Ruhe eingekehrt ist.
Beobachtet man die Kühe/Rinder nur morgens und abends, läuft man Gefahr, Kühe mit kurzer Hauptbrunst zu verpassen. Deshalb sollte man zwei- besser dreimal täglich eine Brunstbeobachtung durchführen (pro 100 Kühe, jeweils mindestens 15 Minuten). So kann eine Trefferquote von 75 % und mehr erreicht werden.
Brünstige Kühe sorgen oft für viel Unruhe und eine Verletzungsgefahr in der Herde. Ist eine Selektion immer empfehlenswert und realisierbar?
Wichtig ist, dass der Beobachter, aber vor allem auch die Kühe, nicht abgelenkt sind, z. B. durchs Füttern. Bei Lohnarbeitsbetrieben ist es sinnvoll, die Mitarbeiter zu schulen, damit die Ergebnisse der Brunsterkennung nicht täglichen Schwankungen unterliegen.
Sensoren überwachen
Wachsen die Herden, wächst auch die Anforderung an die Brunsterkennung. Deshalb setzen immer mehr Betriebe auf Brunsterkennungssysteme (Aktivitätsmessung). Derzeit sind Sensoren zur Fixierung am Fuß, Hals, im Ohr und zur Eingabe in den Pansen erhältlich. Ebenso wie bei der visuellen Beobachtung fallen die Erkennungsraten unterschiedlich hoch aus. In den vergangenen Jahren wurde die Aktivitätsmessung immer häufiger mit anderen Sensor-basierten Daten kombiniert. So werten diese inzwischen u. a. auch Liegedauer, Futtertisch-Besuche, Wiederkau- und Fressverhalten aus. Die Kombination dieser Daten verbessert, neben einer kontinuierlichen Gesundheitsüberwachung, die Brunsterkennung.
Um zu klären, welche Parameter (Kombination) sich für eine Brunsterkennung eignen, wurden an der Universität Gießen (Hoy, 2020) zwei Systeme unter die Lupe genommen (SCR Heatime HR und BayernWatch). Dabei erfasste Heatime das Wiederkauen und die Aktivität. BayernWatch zeichnete die Aktivität, die Aufenthaltsdauer am Futtertisch, die Futtertisch-Besuche, die Anzahl der Liegeperioden, die Liegedauer sowie die Dauer des Stehens auf (Übersicht 1 und 2).
Es zeigte sich, dass die Daten aus dem Fress-/Wiederkauverhalten bzw. Futtertischbesuche, in Kombination mit der Aktivitätsmessung, die Brunsterkennung weiter verbessern können. So können deutlich über 90 % (bis zu 96 %) der brünstigen Kühe (konstant) automatisch erkannt werden.
Dabei arbeiten die Sensoren nach einem Ausschlussverfahren: Brünstige Kühe bewegen sich mehr, fressen jedoch weniger. Aber die Daten sind herdenindividuell. Daher sollte man sich stets bei der Interpretation der Daten (z. B. Wiederkauen) an den Vergleichsdaten der eigenen Herde orientieren.
Achtung: Eine 100-prozentige Sicherheit der automatischen Brunsterkennung ließ sich aber auch bei einer Kombination der verschiedenen Daten (Aktivität und Fress-/Wiederkauverhalten) nicht erreichen. In den Versuchen fielen immer wieder einzelne Tiere auf, bei denen keine der Messgrößen eine Veränderung zeigte. Deshalb gilt es auch beim Sensoreinsatz „die Augen offen zu halten“.
Neben Aktivität und Fressen werden inzwischen in automatischen Melksystemen auch Sensoren zur Progesteronbestimmung eingebaut. Sie sollen neben der normalen Brunsterkennung auch Fruchtbarkeitsstörungen (Stillbrunsten) und Trächtigkeiten ausfindig machen.
Schwanzkreide und Patrone
Neben der automatisierten Brunsterkennung können Aufsprungsdetektoren (Farbpatrone, Schwanzkreide/-farbe, Brunstpflaster) in Kombination mit der visuellen Brunstbeobachtung genutzt werden. Diese machen sich den natürlichen Duldungsreflex der Kühe zunutze. Springt eine andere Kuh auf, verschmiert die Farbe bzw. die Farbpatronen platzen. Diese Markierungshilfen können ebenfalls bei Jungrindern eingesetzt werden.
Beim Einsatz dieser Farbdetektoren muss das etwas aufwendige Ankleben/Markieren beachtet werden. Zudem muss man vor allem bei Farbpatronen bedenken, dass sie keine Aussage über die Brunstqualität (Stärke, Vor- oder Hauptbrunst) geben, da sie nach dem einmaligen Aufsprung platzen.
Farbdetektoren sollten als Ergänzung zur visuellen Brunstbeobachtung gesehen werden. Wichtig bei der Anwendung ist, dass (rotierende) Kuhbürsten das Ergebnis der Markierungshilfen verfälschen oder zu Verlust der Farbpatronen führen können. Manche Herden müssen sich außerdem erst einmal an die Farbe gewöhnen. Besonders in Jungrindergruppen kann es passieren, dass die Markierungen abgeleckt werden.
Auch eine Kombination aus Farbdetektoren und Brunsterkennungssystemen kann sinnvoll sein. Und zwar u. a., wenn stillbrünstige Kühe aufgespürt werden. Zu diesem Ergebnis kam eine Studie der Universität British Columbia (UBC 2021). Hier wurden 1.127 Brunsten erfasst, wovon nur 65,3 % allein mit den Sensoren (Aktivität) als richtig erkannt wurden (Kontrolle mit Ultraschall). Kennzeichnete man außerdem den Schwanzansatz farblich (visuelle Kontrolle), erhöhte sich die Trefferquote auf 88,6 % (Übersicht 3).
Gesteuerte Fruchtbarkeit
Um einer schlechten Brunstnutzungsrate entgegenzuwirken, führen einige Betriebe auch eine Ovulationssynchronisation mit anschließender terminorientierter Besamung durch. Ursprüngliche OvSynch-Programme verhalfen zwar nur zu mäßigen Trächtigkeitsraten von 30 bis 40 %. Unter Berücksichtigung der Abläufe bei der Follikelentwicklung konnte man die Fruchtbarkeitsergebnisse nach terminorientierter Besamung jedoch deutlich verbessern. So werden inzwischen vergleichbare, zum Teil sogar höhere Konzeptionsraten erreicht wie bei Kühen, die nach spontaner Brunst besamt worden sind.
Achtung: Nur eine zeit- bzw. termingerechte Hormon-Applikation verspricht den maximal zu erwartenden Erfolg. Werden zeitliche Vorgaben nicht genau eingehalten, kann dies im Schnitt bis zu 10 % schlechteren Erfolgsaussichten führen. Wichtig zu wissen ist, dass diese Programme nicht in der Lage sind, grobe Fehler in der Haltung und im Management zu kompensieren. Wichtige Faktoren für erfolgreiche Programme sind demnach korrekte Arbeitslisten, zuverlässige Mitarbeiter und eine Selektion/Fressgitter. In Herden mit massiven Problemen bei der Brunsterkennung kann der Hormoneinsatz sinnvoll sein. Der Einsatz lässt sich allerdings im Rahmen einer regelmäßigen Sterilitätskontrolle auf Problemtiere beschränken.
Weitere Infos zum Thema Brunst: