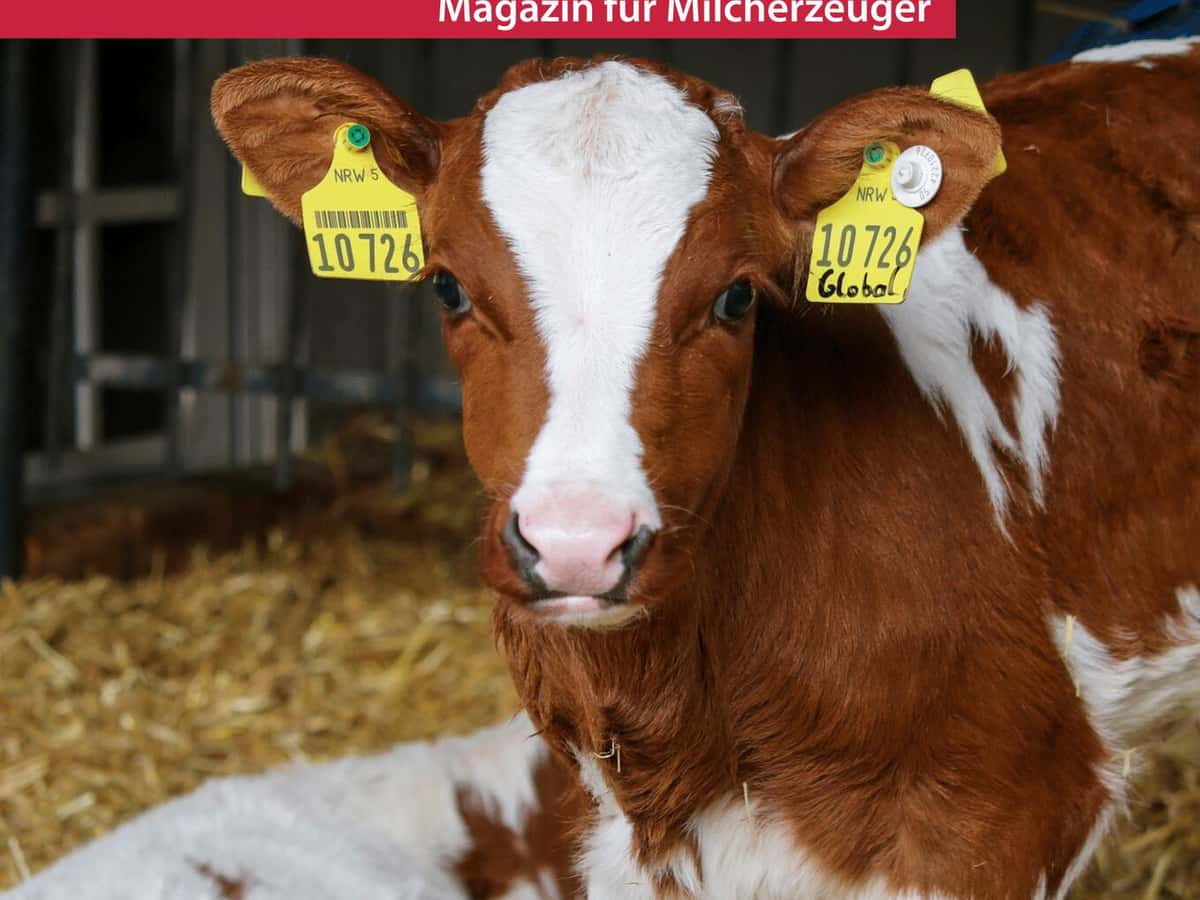In immer mehr Kuhställen werden Sensoren zur Brunsterkennung eingesetzt. Die Sensoren erfassen in der Regel das Aktivitätsverhalten der Milchkühe. Hinter einer überdurchschnittlich hohen Aktivität, wird eine Brunst vermutet. Aus der Praxis wird allerdings immer berichtet, dass bis zu einem Drittel der Kühe, die tatsächlich eine Brunst aufweisen, nicht als solche ausgewiesen werden. Ein Team von Forschenden der Universität British Columbia (UBC) hat sich deshalb Gedanken darüber gemacht, wie sich die stillbrünstige Kühe noch besser aufspüren lassen. Letztlich empfehlen sie, die Kühe im Brunstzeitraum mit einer Schwanzkreide zu markieren (tail chalk). In einer Studie, in der 1.127 Brunsten von 376 Holsteinkühen erfasst wurden, sind nur 65,3 % der Brunsten allein mit den Sensoren als richtig erkannt worden (Kontrolle per Ultraschall). Wurde zusätzlich der Schwanzansatz farblich gekennzeichnet, erhöhte sich die Trefferquote auf 88,6 %. Von den Kühen, die durch die Kombination Farbkreide und Sensor aufgefallen sind, wurde zudem rund 7 % mehr nach der ersten Besamung tragend im Vergleich zu nur mit dem Sensor ausgestatteten Tieren (45 vs. 38 %).
Empfehlung: Auch wenn Sensoren zur Brunsterkennung eingesetzt werden, sollte auf das Auftragen von Schwanzkreide nicht verzichtet werden.
Fettreiche Austauscher mit Vorteilen
Eine an der Universität Guelph angesiedelte Arbeitsgruppe ging der Frage nach, ob sich im Milchaustauscher Laktose in Teilen durch Fett als Energieträger ersetzen lässt. Milchaustauscher enthalten oftmals mehr Laktose als Kuhmilch, da Laktose vergleichsweise günstig in der Beschaffung ist. Allerdings enthält Laktose weniger Energie als Fett, weshalb der Energiegehalt von Milchaustauschern in aller Regel auch geringer ausfällt als der der fetthaltigeren Vollmilch (4,7 vs. 5,4 Mcal kg TM). Der Anteil an Laktose im MAT kann aber nicht unbegrenzt erhöht werden, denn ein hoher Anteil kann bei Kälbern Verdauungsstörungen auslösen.
Um herauszufinden, wie wieviel Laktose ein MAT „verträgt“ wurden in einem Fütterungsversuch (32 HF Kälber) zwei unterschiedlich zusammengesetzte MAT vertränkt: Ein laktosereicher MAT der 37,3 % Laktose und 23,3 % Fett enthielt (herkömmlicher MAT) sowie ein fettreicher MAT mit 44,3 % Laktose und 17,3 % Fett (Inhaltsstoffe in etwa wie Vollmilch). Die Konzentration des MAT wurde auf 150 g pro Liter eingestellt, die Milchtränke die ersten fünf Wochen zur freien Aufnahme angeboten, anschließend erfolgte deine vierwöchige Entwöhnung.
Ergebnis: Es stellte sich heraus, dass der Austausch von Fett durch Laktose sich nicht negativ auf die Nährstoffaufnahme auswirkte. Allerdings schienen die mit dem laktosereichen MAT getränkten Kälber während des Absetzens (35. bis 56. Tag) mehr Hunger zu verspüren. Sie besuchten deutlich häufiger die Tränkestation. Auch wurden im Blutplasma der Kälber geringere Cholesterol-Konzentrationen gemessen. Hohe Cholesterol-Werte gehen oftmals mit einer besseren Tiergesundheit einher. Die Forschenden empfahlen der Industrie, die Nährstoff-Zusammensetzung der MAT zu überdenken und gegebenenfalls anzupassen.
Futteraufnahme bestimmt Beginn der Entwöhnung
An der Universität British Columbia (UBC) wurde untersucht, welche Methode sich am besten eignet um Tränkekälber von der Milch abzusetzen. Hintergrund ist, dass in der Praxis immer wieder zu beobachten ist, dass Kälber, die täglich bis zu 12 Liter Milch erhalten, sich schwer tun mit der Aufnahme festen Futters. Miteinander verglichen wurden drei Entwöhnungs-Methoden. Absetzen der Milch bei Erreichen …
- eines bestimmten Alters (die Milchtränke wurde ab dem 32. nochmals am 62. Tag reduziert. Ab dem 70. Tag wurde die Milchtränke endgültig ausgesetzt);
- einer definierten Festfutteraufnahme (die Milchtränke wurde ab dem 32. Tag reduziert, eine weitere Verringerung erfolgte, sofern die Kälber 200 g TM an Festfutter aufgenommen haben. Das war etwas ab dem 45. Tag der Fall. Endgültig ausgesetzt wurde die Milchtränke am 70. Tag);
- eine Kombination aus beidem (die Milchtränke wurde ab dem 32. Tag reduziert, eine weitere Verringerung erfolgte, sofern die Kälber 200 g, 600 g sowie 1.150 g TM an Festfutter aufgenommen haben. Endgültig ausgesetzt wurde die Milchtränke am 58. Tag).
Zudem wurde geprüft, ob bzw. welche Effekte sich durch die Zufütterung von Heu, Grassilage oder einer TMR (46 % KF) ergeben. Insgesamt nahmen 108 neugeborene Kälber an der Studie teil. Allen Tieren wurden an einer Futterbar, die aus mehreren parallel angeordneten Abrufautomaten bestand, die einzelnen Futtermittel zugeteilt (Wasser, Milchtränke, Festfutter).
Ergebnis: Das Absetzen, das sich an der Höhe der Festfutteraufnahme orientierte, stellte sich als „beste“ der drei Methoden heraus. Bei dieser Methode lässt sich am ehesten eine hohe Nährstoffaufnahme sicherstellen. Allerdings führte diese Strategie zu vermehrten Besuchen ohne Tränkeanrecht an der Tränkestation. Etwas abmildern lässt sich dieser Effekt durch die Beifütterung von gutem Heu.
Aminosäuren verhindern Muskelabbau
Eine interessanten Vortrag hielt Dr. Jackie Boermann von der Purdue Universität, in dem sie auf den oftmals unterschätzten Abbau von Muskelmasse während der Transitphase verwies. Leistungsstarke Milchkühe schmelzen nicht nur Fett ein um das Energiedefizit zu minimieren, nicht selten wird auch Muskelmasse in nicht unerheblichem Umfang abgebaut, u.a. um den Proteinstoffwechsel abzusichern (Aminosäuren). Dieser Vorgang setzt bereits drei bis zwei Wochen vor der Kalbung ein. Ein Mangel an Aminosäuren wirkt sich nach der Kalbung begrenzend auf die Milchleistung aus. So konnte in mehreren Studien nachgewiesen werden, dass eine Zufuhr von Aminosäuren (Casein), deren Zusammensetzung jenen in der Milch enthaltenen entspricht, sich positiv auf die Milchleistung auswirkt.
Empfehlung: Ob eine hochtragende bzw. frischabgekalbte Kuh Muskelmasse abbaut, dass lässt sich „von außen“ nicht so einfach beurteilen, denn ein Rückgang des BCS resultiert nicht unbedingt auch in einem Abbau von Muskelmasse. Eine genaue Beurteilung ist nur per Ultraschall möglich. Doch dazu müssten die Kühe zwei Mal untersucht werden, etwa 21. Tage vor und nochmals 21. Tage nach der Abkalbung. Praxistauglicher scheint das Verhältnis von 3-Methylhistidin und Kreatinin. Je höher der Wert, desto wahrscheinlicher ist ein Muskelabbau.
Trockensteherrationen anfeuchten
Trevor DeVries von der Universität Guelph rief dazu auf, alles dran zu setzen um die Trockenmasseaufnahme trockenstehender Kühe zu maximieren. Der Fütterungsexperte empfiehlt vor der Abkalbung eine struktur(stroh)reiche Futterration mit begrenzter Energiedichte zu füttern. Diese sollte einen möglichst geringen Trockenmassegehalt aufweisen, um den Kühen das Aussortieren von feinen Futterpartikeln zu erschweren. Wird das Stroh kurz gehäckselt (2 bis 3 cm Länge) führt nach der Kalbung zu höheren pH im Pansen und geringeren Stoffwechselbelastung (niedrigere BHB-Werte).
Empfehlung: DeVries empfiehlt, den Trockenmassegehalt der Ration auf max. 45 % zu begrenzen, da so der pH im Pansen abgesichert werden kann. Alternativ kann im Futtermischwagen dem Stroh auch Melasse zugesetzt werden.
Fruchtbarkeit vorhersagen
Einen Hinweis auf die spätere Fruchtbarkeit von Rindern lässt sich bereits während deren Pubertät anhand eines anatomischen Merkmals ablesen: der Anogenital-Distanz. Gemeint ist damit der Abstand zwischen dem Anus (After) und dem Genital (Scheide) eines Rinds. Forschende der Universität Sasketchewan fanden heraus, dass eine kurze Distanz (Abstand) bessere Fruchtbarkeitsergebnisse erwarten lässt. Bei ausgewachsenen Kühen wurde dieser Zusammenhang bereits mehrfach festgestellt.
Unterschieden wurde in der Studie zwischen einer kurzen (< 110 mm) bzw. einer langen (> 110 mm) Anogenital-Distanz (gemessen wurden Wert von 69 bis 142 mm). Rinder mit einer kurzen Distanz wurden zwei Monate früher tragend (14,9 vs. 15,1 Monate), auch mussten sie seltener besamt werden (1,5 vs. 1,7 Besamungen). Noch deutlichere Unterschiede zeigten sich bei den Trächtigkeitsergebnissen: Während nach 450 Tagen waren nur noch 23,6 % der Rinder mit einer kurzen Distanz „leer“ waren, war dies bei 40,3% der Rinder mit einer Distanz über 110 mm der Fall.
Empfehlung: Die Forschenden empfehlen, die anatomischen Unterschiede als genetisches Merkmal zur Selektion aufzunehmen werden.
Färsen nicht zu früh besamen
Die Frage, wie lange nach dem Abkalben mit der ersten Besamung abgewartet werden sollte, beschäftig derzeit viele Milcherzeuger – aus unterschiedlichen Gründen. Aus biologischer Sicht sollten Kühe das erste Mal wieder besamt werden, wenn sichergestellt ist, dass die Rückbildungsprozesse im Genitaltrakt (Geschlechtsorgane) abgeschlossen sind und die Kuh nur noch geringfügig oder keine körpereigene Reserven mehr einschmilzt. In der Regel ist dies am 40. oder 50 Laktationstag der Fall. Ab diesem Zeitpunkt könnte eine Milchkuh theoretisch also wieder besamt werden. Viele Milcherzeuger setzen denn auch die FWZ auf 50 oder 60 Tage fest, obwohl die Chance eine hochleistende Milchkuh zu diesem Zeitprunkt trächtig zu bekommen, relativ gering ist. Andererseits ist erwiesen, dass der Besamungsbeginn letztlich die Trächtigkeitsrate zum Ende der Laktation nicht beeinflusst. Letztlich muss sich jede Entscheidung, egal ob die Wartezeit kurz oder eine lang ausfällt, an ökonomischen Kennwerten messen lassen.
Ein Team an Wissenschaftlern der Cornell Universität hat untersucht, ob sich eine Verlängerung der freiwilligen Wartezeit (FWZ) wirtschaftlich rechnet. In einer Studie wurden 2.426 Kühe entweder am 60. oder aber „erst“ am 88. Tag das erste Mal besamt. Um Umwelteffekte auszuschließen, wurde zuvor der Zyklus der Tiere synchronisiert. Ergebnis: Das längere Abwarten ließ die Trächtigskeitsraten ansteigen. Von den Färsen, die am 88. Tag erstmals besamt wurden, haben direkt 55 % aufgenommen und somit 8,7 % mehr als bei einer FWZ von 60 Tagen. Der gleiche Effekt zeigte sich auch bei den ausgewachsenen Milchkühen, nur fiel hier der Unterschied geringer aus (40,1 % vs. 36,5 %). Letztlich hatte die Länge der FWZ aber keinen Einfluss, denn am Laktationsende waren gleich viele Tiere trächtig. Wie also agieren? Hier hilft es, einen Blick auf die Kosten zu werfen.
Empfehlung: Werden alle Aufwendungen für Futter, Medikamente, Besamung und Aufzucht einbezogen, so lässt sich festhalten: Färsen sollten erst später (am 88. Laktationstag) erstmals besamt werden, Kühe können hingegen schon ab dem 60. Tag belegt werden (der CashFlow erhöht sich so um 68 bzw. 86 USD pro Tier).