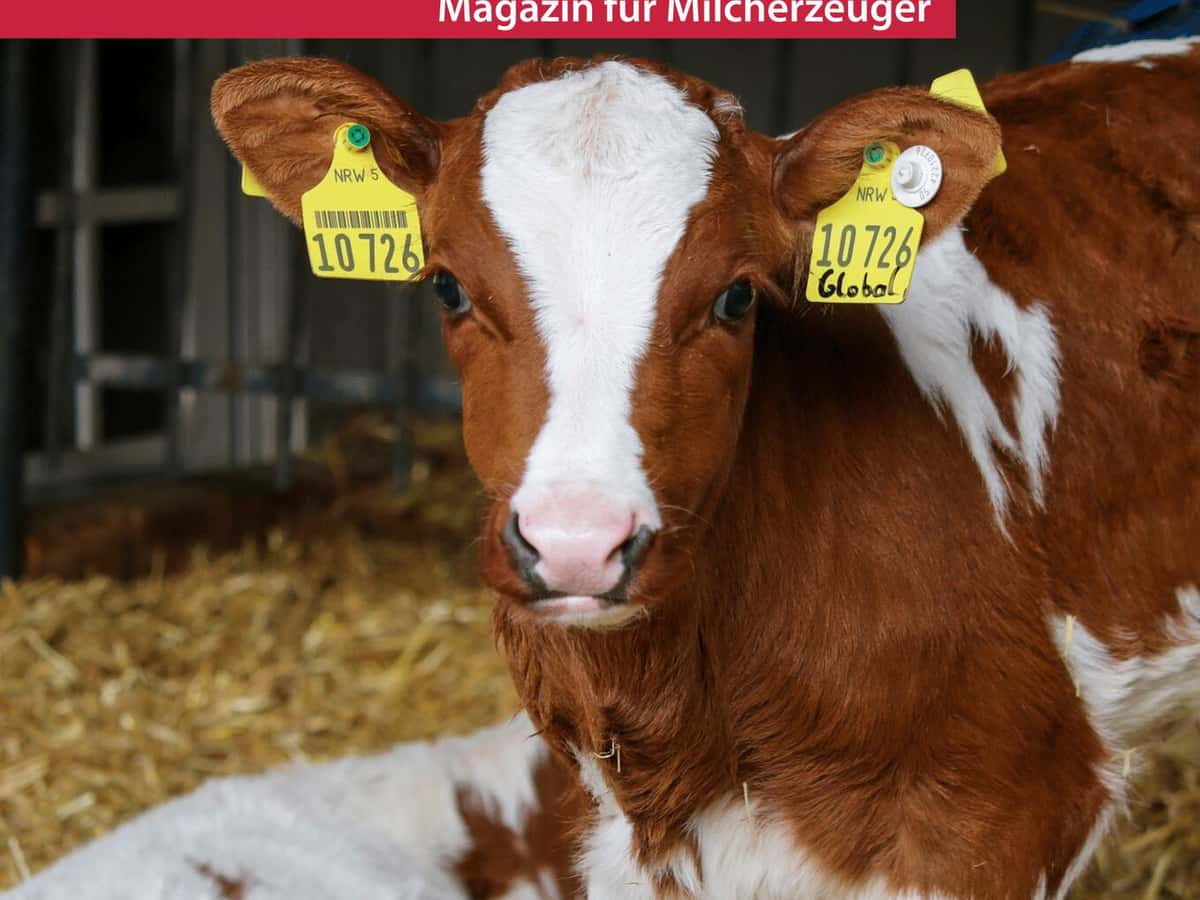Forschung
Die Ökobilanz der Milchproduktion
In einer Studie wurden die Effekte der Milchproduktion auf die Umwelt untersucht. Demnach verbessern vor allem Weide und heimische Futtermittel die Ökobilanz.
16 verschiedene, „typische“ Betriebsmodelle der Milchkuhhaltung wurden verglichen

„Typisch“ für die Modellregion „Allgäu“ wurden Fleckvieh-Herden mit Bestandsgrößen von 40 Kühen angenommen. (Bildquelle: Stöcker-Gamigliano, Landwirtschaftsverlag GmbH)
- Region Nord (bzw. Nordwestdeutschland mit dem nördlichen Teil Niedersachsens und dem Bundesland Schleswig-Holstein), Herdengröße pro Betrieb: 120 Kühe, Rasse: Holstein
- das Allgäu (mit den angrenzenden Regionen Oberbayern, Schwäbische Alb), Herdengröße: 40 Kühe, Rasse: Fleckvieh
- die Mittelgebirgsregionen in Rheinland-Pfalz (Eifel) und Nordrhein-Westfalen (Bergisches Land), Herdengröße: 100 Kühe, Rasse: Holstein
- Region Ost mit Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg, Herdengröße: 500 Kühe, Rasse: Holstein
- Berücksichtigt wurden Betriebe mit mittlerer Leistung, die nach den aktuellen gesetzlichen Vorgaben arbeiten.
- Keine Berücksichtigung fanden in der Praxis bereits etablierte Ansätze zur Verbesserung der Umweltwirkung, die über den gesetzlichen Standard hinausgehen. Wie z.B. emissionsmindernde Haltungsverfahren, Güllebehandlung oder regenerative Ansätze im Futterbau.
- Haltung der Tiere, jeweils untergliedert nach Milchkühen, Kälbern und Jungvieh;
- Futtermittelbereitstellung, inklusive der Ermittlung des Energiebedarfs, des Grund- und Kraftfutterbedarfs und daraus abgeleiteter Futterrationen;
- Stallgebäude und dazugehörige baulichen Anlagen (Wirtschaftsdüngerlager) inkl. Einstreu;
- Berechnung der Emissionen aus Stall, Wirtschaftsdüngerlager und Weide und
- Humusbilanz und Humusveränderung im Zuge des Eigenfutteranbaus.
Ansatzpunkte, wie Milcherzeugerbetriebe ihre Ökobilanz verbessern können
Die wichtigsten Stellschrauben zur Verbesserung der Umweltauswirkungen von Milchproduktionssystemen finden sich in der Fütterung.“

Kraftfutter hat laut der Studie einen hohen Einfluss auf die Ökobilanz. Bei ökologischer Ware haben die geringeren Hektarerträge einen negativen Effekt, bei konventioneller Ware Komponenten aus dem Ausland. (Bildquelle: Berkemeier, Landwirtschaftsverlag GmbH)
- Bessere Umweltverträglichkeit durch Weidehaltung: Alle Betriebsmodelle mit Weidehaltung zeichneten sich im Vergleich zu denen ohne Weidehaltung durch niedrigere Werte für die verschiedenen Umweltwirkungen aus. Besser schnitten sie insbesondere bei den Wirkungskategorien Energieaufwand, Wasserverbrauch, Süßwasser-Eutrophierung, terrestrische Versauerung, terrestrische Toxizität und Aquatoxizität. Zu beachten: Für die Weideflächen wurde keine mechanisierten Arbeitsverfahren und nur eine Düngung mit wirtschaftseigenem Dünger (Gülle) angenommen!
- Kraftfuttereinsatz: Hauptanteil an den fütterungsbedingten Umweltbelastungen macht die Zusammensetzung und die Komponentenherkünfte der Kraftfutter aus. Zu beachten: Für die untersuchten Betriebsmodelle wird angenommen, dass die Betriebe alle fertige Milchleistungsfutter zukaufen. Durch den Ersatz von sojabasierten Komponenten durch einheimische Futterleguminosen lässt sich die Ökobilanz laut der Studie verbessern – „sofern die ernährungsphysiologischen Bedürfnisse der Tiere berücksichtigt werden“. Aufgrund der geringeren Hektarerträge weise Bio-Milchleistungsfutter trotz heimischer Herkünfte besonders große Umweltauswirkungen pro kg Futter auf. Somit gilt für konventionell wie für ökologisch wirtschaftende Betriebe: Je weniger Milchleistungsfutter eingesetzt werden muss, desto günstiger wirkt sich dies auf die Umweltbelastung der Milch aus.
- Milchleistung hat ihre Grenzen: Im Gegensatz zu unterdurchschnittlichen Milchleistungen ergeben sich zwischen einer Milchleistung von 8.500 kg ECM und 10.000 kg ECM und darüber hinaus kaum noch Unterschiede beim Treibhausgaspotenzial. Entscheidend ist im Zusammenhang jedoch die Futterration. Anzustreben hinsichtlich der Ökobilanz sind hohe Grundfutterleistungen und der Einsatz heimischer Kraftfutterkomponenten.
- Überwiegend bessere Umweltverträglichkeit durch ökologische Bewirtschaftung: Die ökologischen Betriebsmodelle wiesen für die Mehrzahl der betrachteten Indikatoren gegenüber den konventionell wirtschaftenden Betriebsmodellen laut den Autoren „mehr oder weniger deutliche“ Umweltvorteile auf. Eindeutig besser schnitten die konventionellen Betriebsmodelle in Bezug auf das terrestrische Versauerungspotenzial und bei der Inanspruchnahme landwirtschaftlicher Flächen ab.
- Nutzungsdauer: Die Annahme einer höheren durchschnittlichen Laktationszahl der Milchkühe senkte die die Umweltbelastungen in allen betrachteten Wirkungskategorien nur vergleichsweise leicht.
- Herdengröße ohne Einfluss: Keinen relevanten Einfluss auf die Ökobilanz hat laut der Studie die Größe des Rinderbestandes – weder in den konventionellen noch in den ökologisch wirtschaftenden Betrieben.
- Region ohne Einfluss: Auch wenn sich die Grundfuttererzeugung in Hinblick auf Ackerland- und Grünlandflächen in den ausgewählten Regionen mitunter deutlich unterscheiden, ergeben sich laut den Autoren der Studie bezogen auf das Endprodukt Milch für die Regionen jeweils vergleichbare Umweltbelastungen.
Monetarisierung bisher wenig aussagekräftig, Einfluss auf Biodiversität nicht erfasst
Empfehlungen an die Politik: Grünlandbasierte Systeme und heimische Kraftfutterkomponenten fördern

Der Einsatz von einheimische Futterleguminosen, wie z.B. Ackerbohnen, statt aus Übersee importierter Soja verbessern die Ökobilanz von Milcherzeugerbetrieben. (Bildquelle: Berkemeier, Landwirtschaftsverlag GmbH)
- „Die Ergebnisse können genutzt werden, um aufzuzeigen, mit welchen Vorteilen und welchen Nachteilen für die Umwelt bestimmte Betriebssysteme in der Milchproduktion verbunden sind. Die Ergebnisse können Forderungen stützen, umweltvorteilhaftere Systeme stärker zu fördern.“
- „Die wichtigsten Stellschrauben zur Verbesserung der Umweltauswirkungen von Milchproduktionssystemen finden sich in der Fütterung.“
- „Je weniger Milchleistungsfutter eingesetzt wird, desto günstiger wirkt sich dies auf die Umweltbilanz der produzierten Milch aus. Die Menge und die Zusammensetzung des eingesetzten Milchleistungsfutters hat einen großen Einfluss auf die Höhe der Umweltbelastungspotenziale der untersuchten Wirkungskategorien.“
- „Der Einsatz von einheimische Futterleguminosen, z.B. Ackerbohnen, statt aus Übersee importiertes Soja bringt potenzielle Umweltverbesserungen in den untersuchten Wirkungskategorien mit sich.“
- „Durch eine Erhöhung des grünlandbasierten Anteils im Grundfutter können Umweltentlastungeffekte erzielt und die Umweltkosten gesenkt werden. Dies kann durch Weidegang und / oder eine Erhöhung des Anteils an Grassilage und Heu im Grundfutter erfolgen.“
Ökobilanz – was ist das und wie sind die Ergebnisse zu betrachten?
Mehr zu dem Thema